Zurück zu den Schlüsselsituationen
Regeln der Institution durchsetzen – Handeln im Spannungsfeld zwischen Haltung und organisationalem Auftrag
- Es bestehen Richtlinien, Regeln, Vorgaben der Institution, die die Funktionsweise und das Zusammenleben regeln und die sowohl der Klientel als auch den PSA bekannt sind
- Die Klientel weigert sich, eine an sie/ihn gestellte Anforderung zu erfüllen bzw. verstösst gegen eine Regel
- Die Situation kann ein Momentum des Grenzen Testens enthalten
- Die Situation kann auch für nicht-direkt Betroffene eine Botschaft enthalten, die in Form von Lernen am Modell aufgenommen werden kann
- Die/der PSA ist interessiert, eine gemeinsame Ebene des Verstehens zu finden, damit die Regeln eingehalten werden können
- PSA haben grundsätzlich den Auftrag, nach den Regeln der Institution zu handeln
- Die Ziele für die Zusammenarbeit zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen und die Vorstellungen über die Vorgehensweise gehen bei den Beteiligten (KlientInnen, andere am Problem oder der Lösung Beteiligte, der Sozialarbeiter aus seiner professionellen Sichtweise, das offizielle Mandat, dem der Sozialarbeiter verpflichtet ist) auseinander.
Kontext
Die Organisation ist ein begleitetes Wohnen in der stationären Jugendarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Durch die interdisziplinäre Kooperation zwischen Sozialpädagogik, Psychotherapie und Arbeitsintegration sollen die lebenspraktischen Fähigkeiten der Bewohnenden bis zur Eigenständigkeit gefördert werden. Neben den internen Instanzen besteht auch die Zusammenarbeit mit Behörden, Ärzt:innen und Eltern.
Jede bewohnende Person hat eine sozialpädagogische und psychotherapeutische Bezugsperson. Psychotherapeutische Sitzungen sind einmal wöchentlich geplant und obligatorisch. Wenn Bewohnende keiner Schule oder keinem Lehrbetrieb angegliedert sind, werden sie in die interne Arbeitsintegration eingeteilt.
Die Bewohnenden sind je nachdem freiwillig, unfreiwillig oder in seltenen Fällen verdeckt platziert. Das Ziel der Praxisorganisation ist es, den Jugendlichen eine Obhut zu bieten, einen Rhythmus in den Alltag zu geben und sie beim Einfinden in die Arbeitswelt zu unterstützen und zu begleiten. Die jungen Menschen haben häufig eine Geschichte, in der sie viele Abbrüche erlebt haben, Bindungsstörungen entwickelten und somit Belastungen unterschiedlichen Ausmasses mit sich bringen. Daher ist der Beziehungsaufbau zwischen Bewohnenden und sozialpädagogischen Fachkräften ein zentrales Element der alltäglichen Arbeit.
Ausgangslage
Die PSA ist gemeinsam mit ihrer Praxisausbildnerin (PA) die Co-Bezugsperson der 16-jährigen Klientin (KL). Die KL ist Mutter eines Säuglings, der bei einer Pflegefamilie platziert ist. Die KL ist seit etwa zwei Monaten in diesem Jugendheim und war davor schon in verschiedenen Heimen und Pflegefamilien. Ihre Mutter ist im letzten Jahr gestorben. Sie hat fünf Geschwister. Der Vater der KL, der ein autoritäres Auftreten hat und ihre älteste Schwester scheinen wichtige Bezugspersonen zu sein. Den Akten nach beschreiben verschiedene Fachkräfte die KL als unzuverlässig und realitätsfern. Die KL befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Abklärung von ADHS, Borderline-Persönlichkeitsstörung und Depressionen.
Der Auftragsbereich der PSA besteht unter anderem darin, die KL zu externen Terminen zu begleiten. Heute steht die Begleitung zu einem Gynäkologie-Termin an. Dass die KL immer in Begleitung zu Terminen gehen soll, wurde entschieden, da es mehrfach vorgekommen ist, dass die KL zwar pünktlich für einen Termin losgegangen, dort jedoch nicht erschienen ist, da sie stattdessen woanders hingegangen und teilweise anschliessend auch nicht mehr zurückgekommen ist, sondern bei ihrem Freund oder Vater blieb. Es kam auch schon vor, dass die KL eigenständig zum Arzt ging, Medikamente verschrieben bekommen hat und dies dem sozialpädagogischen Team nicht mitgeteilt hat. Einerseits verfügt die KL häufig nicht über genügend Geld, um die Medikamente abzuholen, andererseits ist es den Bewohnenden ausser in Ausnahmefällen nicht gestattet jegliche Medikamente bei sich zu tragen oder bei sich im Zimmer zu lagern. Dies aufgrund der Gefahr des Medikamentenmissbrauchs sowie der Unzuverlässigkeit der rezeptpflichtigen Einnahme/Dosierung.
Die Situation spielt sich draussen vor dem Haus ab. Die KL raucht und unterhält sich mit einer anderen Bewohnerin (BW). Es ist abgemacht, dass die PSA die KL heute zum zweiten Mal zum Gynäkologie-Termin begleitet. Die PA ist in der Nähe aber drinnen.
Situation
Zur besprochenen Zeit macht sich die PSA auf die Suche nach der KL, um gemeinsam losgehen zu können. Die PSA trifft sie vor dem Haus rauchend an. Eine andere Bewohnerin (BW) steht bei ihr. Die PSA fragt sie, ob sie bereit sei.
Da erwidert sie, dass sie bereit sei aber nicht von der PSA begleitet werden wolle. Als die PSA nachfragt, weshalb, und darauf hinweist, dass sie es im Vorhinein abgesprochen haben, meint die KL, dass es ihr unangenehm sei von einem „Sozis“ begleitet zu werden. Es sei ihr zu intim und dass es eine Angelegenheit der Privatsphäre sei. Sie fände es „unfair“, dass sie nicht mitbestimmen könne. Bisher kam es für sie nur in Frage von ihrem Vater oder ihrem Freund begleitet worden zu sein. Sie könne es auch alleine. Wenn, dann würde sie höchstens von einer Freundin begleitet werden wollen und deutet auf die Bewohnerin.
Die PSA sagt, dass sie sie gut verstehen könne. Und betont, dass die PSA wie beim letzten Mal im Wartezimmer bleiben werde, da es der PSA wichtig ist ihre Privatsphäre zu respektieren. Die PSA erinnert sie daran, dass es das letzte Mal doch sehr lustig war und es der PSA neu ist, dass es ihr zu intim sei. Die PSA erklärt ihr, dass es auch darum gehe eine Beziehung zwischen ihnen aufzubauen sowie sicherzustellen, dass alle neuen Gesundheitsinformationen zum sozialpädagogischen Team gelangen. Auch wenn neue Medikamente verschrieben werden, muss das Team das wissen, damit eine Übersicht über die Finanzen bestehen bleibt, sowie, um die KL in der regelmässigen Einnahme der Medikamente unterstützen zu können. Es ginge nur um den Weg hin und zurück, dass sie sicher ankomme und keine Informationen verloren gehen.
Die KL weigert sich weiterhin von der PSA begleitet zu werden und meint, dass die „Sozis“ sie nur kontrollieren wollten. Die andere Bewohnerin stimmt ihr zu und sagt auch, dass es nicht ginge, dass die „Sozis“ ihre Privatsphäre missachten. Da die PSA den Eindruck hat, dass sie noch stärker auf ihrer Meinung verharrt, weil sie sich von der anderen Bewohnerin bestärkt fühlt, macht die PSA den Vorschlag diese Diskussion zu zweit weiterzuführen. Beide zeigen keine Bereitschaft, der Bitte der PSA nachzukommen. Sie bleiben stehen, selbst als die PSA auffordert, dass die andere Bewohnerin weggehen soll oder, dass die KL und die PSA einen anderen Raum aufsuchen sollen.
Der PSA gehen die Argumente sowie die Handlungsmöglichkeiten aus. Da die PSA die KL zudem gut verstehen kann, hat die PSA keine Motivation mehr sie zu drängen. Die PSA holt die PA zur Hilfe und schildert ihr zuvor kurz die Situation. Als die PA dazu kommt, meint sie bestimmt mit forschem Ton, dass es nichts zu diskutieren gäbe und dass die PSA und die KL jetzt einfach losgehen sollen. Weder die KL noch die andere Bewohnerin widersprechen ihr. Die KL und die PSA gehen zusammen aufs Tram.
Erste Sequenz: PSA sucht KL
„Zur besprochenen Zeit macht sich die PSA auf die Suche nach der KL, um gemeinsam losgehen zu können. Die PSA trifft sie vor dem Haus rauchend an. Eine andere Bewohnerin (BW) steht bei ihr. Die PSA fragt sie, ob sie bereit sei.“
Reflection in Action:
- Emotion KL: Ich fühle mich sicher, stark und selbstsicher, weil ich eine klare Meinung im Kopf habe und nicht alleine bin (BW). Ich fühle mich mutig und klar, weil ich der PSA meine standhafte Meinung mitteilen und darauf beharren werde. Ich fühle mich ein wenig nervös, weil mich eine Konfrontation mit der PSA erwartet, da ich einen Einwand gegen die Abmachung habe.
- Emotion BW: Ich fühle mich feindselig und misstrauisch, weil die PSA kommt und irgendetwas will. Ich fühle mich gegenüber der PSA abwehrend. Ich fühle mich dumpf und taub und habe keine bewusste Körperwahrnehmung.
- Emotion PSA: Ich fühle mich überrascht, dass die KL schon bereit steht. Ich fühle mich unsicher in Bezug auf die Begegnung mit der KL, da ich nicht weiss, ob sie bereit ist. Ich freue mich alleine Zeit mit der KL zu verbringen.
- Kognition PSA: „Oh, sie steht pünktlich bereit. Ich muss sie nicht mal suchen.“ „Los geht’s!“ „So, ich mache das jetzt!“
- Beobachterin:
- PSA hat geschlossene/gebückte Körperhaltung, Körperhaltung ist auch eher unsicher
- KL sagt verbal sie ist bereit und ist währenddessen mit dem Oberkörper in der Rücklage (widersprüchlich wahrgenommen)
Zweite Sequenz: Widerstand Klientin
„Da erwidert sie, dass sie bereit sei aber nicht von der PSA begleitet werden wolle. Als die PSA nachfragt, weshalb, und darauf hinweist, dass sie es im Vorhinein abgesprochen haben, meint die KL, dass es ihr unangenehm sei von einem „Sozis“ begleitet zu werden. Es sei ihr zu intim und dass es eine Angelegenheit der Privatsphäre sei. Sie fände es „unfair“, dass sie nicht mitbestimmen könne. Bisher kam es für sie nur in Frage von ihrem Vater oder ihrem Freund begleitet worden zu sein. Sie könne es auch alleine. Wenn, dann würde sie höchstens von einer Freundin begleitet werden wollen und deutet auf die Bewohnerin.“
Reflection in Action:
- Emotion KL: Ich fühle mich angespannt, weil ich die „Auflehnung“ gegen die Abmachung und meine Argumente gut rüberbringen will. Ich fühle mich ärgerlich/wütend und fremdkontrolliert, weil ich mich ohne Selbstbestimmung und unfair behandelt fühle. Ich fühle mich zielstrebig und klar, weil ich standhaft in meiner Meinung bin. Ich fühle mich abwehrend und erdrückt, weil ich das Gefühl habe fremdbestimmt zu werden. Ich fühle mich schlagfertig, weil ich durch meine guten Argumente ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erhalte.
- Emotion BW: Ich fühle mich genervt von der PSA und dass sie uns in unserem Raum stört (gechillt rauchen). Ich fühle mich angespannt, aufgrund der angespannten Situation. Ich fühle mich verständnisvoll und solidarisch gegenüber der KL und abwehrend gegenüber der PSA.
- Emotion PSA: Ich fühle mich nicht präsent in der Situation und gegenüber der KL. Ich fühle mich allgemein verunsichert mit dem Auftrag und der Situation. Ich fühle mich etwas genervt und angespannt/gestresst, weil sich der Zeitplan durch den Konflikt verzögert. Ich fühle mich nervös bezüglich der Reaktion der KL, weil ich auf sie eingehen möchte und dabei überzeugende Argumente sammeln möchte. Ich fühle mich verständnisvoll der KL und ihrer Argumentation gegenüber.
- Kognition PSA: „Ich versteht dich voll!“ „Schon wieder die gleiche Leier…“ „Muss das jetzt sein?! Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis das Tram kommt.“ „An deiner Stelle würde ich mich ähnlich fühlen.“ „Das ist jetzt eine doofe Situation, weil ich dich gut verstehen kann aber wir losmüssen und ich nicht versagen darf bei einer so kleinen Aufgabe.“
- Beobachterin:
- KL bewegt sich viel, verlagert das Gewicht auf je das eine und dann das andere Bein. Stimmlich ruft sie viel aus und variiert zwischen hoch und tief.
- PSA hat eine gekrümmte Haltung, spielt mit ihren Händen und auch mit ihrem einen Hosenbein.
- Die Bewohnerin steht aufrechter und ihre Stimme ist ruhiger, verändert auch die Tonlage nicht stark. Sie bewegt sich viel weniger im Vergleich zur KL.
Dritte Sequenz: Argumentation PSA
„Die PSA sagt, dass sie sie gut verstehen könne. Und betont, dass die PSA wie beim letzten Mal im Wartezimmer bleiben werde, da es der PSA wichtig ist ihre Privatsphäre zu respektieren. Die PSA erinnert sie daran, dass es das letzte Mal doch sehr lustig war und es der PSA neu ist, dass es ihr zu intim sei. Die PSA erklärt ihr, dass es auch darum gehe eine Beziehung zwischen ihnen aufzubauen sowie sicherzustellen, dass alle neuen Gesundheitsinformationen zum sozialpädagogischen Team gelangen. Auch wenn neue Medikamente verschrieben werden, muss das Team das wissen, damit eine Übersicht über die Finanzen bestehen bleibt, sowie, um die KL in der regelmässigen Einnahme der Medikamente unterstützen zu können. Es ginge nur um den Weg hin und zurück, dass sie sicher ankomme und keine Informationen verloren gehen.“
Reflection in Action:
- Emotion KL: Ich fühle mich eingeengt und ausgestellt, aufgrund der Konfliktsituation. Die PSA redet mit mir und die BW hört alles mit. Ich fühle mich gleichgültig, weil ich den Plan verfolge auf meiner Meinung zu verharren. Ich fühle mich misstrauisch, weil ich kein Vertrauen in die Institution habe, noch in das, was die PSA sagt. Ich fühle mich tapfer, weil ich diese Situation aushalte. Ich fühle mich ein wenig einsichtig, weil die PSA teilweise gute Argumente hat. Ich fühle mich genervt, weil ich keine Lust darauf habe den Argumenten der PSA zuzuhören.
- Emotion BW: Ich fühle mich stark, selbstsicher, abgrenzend und abwehrend gegenüber der Forderung der PSA wegzugehen. Ich fühle mich selbstzufrieden meine eigene Meinung durchgesetzt zu haben und mich behauptet zu haben.
- Emotion PSA: Ich fühle mich genervt, weil es eigentlich schon besprochen wurde und es das letzte Mal gut war. Ich fühle mich lustlos hin und her zu diskutieren. Ich fühle mich verständnisvoll der KL gegenüber. Ich fühle mich nervös, weil ich die KL verstehe, mir nicht sicher bin, ob ich hinter meinem Auftrag stehe und ihn trotzdem erfüllen und durchboxen muss. Ich fühle mich wohlwollend, weil ich die KL verstehe, ihr doch aber die Situation erklären will und ihr nichts Böses will.
- Kognition PSA: „Stehe ich hinter meinem Auftrag?“ „Mir ist alles ein wenig egal.” „Das sind doch gute Argumente, weshalb geht sie nicht darauf ein?“ „Was checkt sie nicht?“ „Komm schon, geht drauf ein. Wir haben’s doch gut zusammen.“
- Beobachterin:
- PSA hat eine aufrechte Körperhaltung, gestikuliert viel, hat eine klare und bestimmte Stimme.
- KL hat einen standhaften Blick zur PSA
- BW schaut mehr in der Gegend umher.
Vierte Sequenz: KL + BW gegen PSA
„Die KL weigert sich weiterhin von der PSA begleitet zu werden und meint, dass die „Sozis“ sie nur kontrollieren wollten. Die andere Bewohnerin stimmt ihr zu und sagt auch, dass es nicht ginge, dass die „Sozis“ ihre Privatsphäre missachten. Da die PSA den Eindruck hat, dass sie noch stärker auf ihrer Meinung verharrt, weil sie sich von der anderen Bewohnerin bestärkt fühlt, macht die PSA den Vorschlag diese Diskussion zu zweit weiterzuführen. Beide zeigen keine Bereitschaft, der Bitte der PSA nachzukommen. Sie bleiben stehen, selbst als die PSA auffordert, dass die andere Bewohnerin weggehen soll oder, dass die KL und die PSA einen anderen Raum aufsuchen sollen.“
Reflection in Action:
- Emotion KL: Ich fühle mich ermutigt und standhaft, weil die BW mir den Rücken stärkt. Ich fühle mich streitlustig, weil es Spass macht zu zweit gegen die PSA zu sein. Das fühlt sich stark und machtvoll an. Ich fühle mich siegessicher, weil meine guten Argumente von der BW bestärkt werden.
- Emotion BW: Ich fühle mich genervt und misstrauisch gegenüber der PSA. Ich fühle mich etwas gleichgültig als Selbstschutz. Ich fühle mich schadenfroh, weil die PSA keine Chance gegen uns zwei hat. Ich fühle mich selbstsicher, weil die PSA aufzugeben scheint.
- Emotion PSA: Ich fühle mich unsicher, weil ich keine Ideen mehr habe und in der Minderzahl bin. Ich fühle mich entmutigt, weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Ich fühle mich klein, weil ich in der Minderheit bin und die anderen in ihrer Meinung und Haltung standhaft scheinen. Ich fühle mich initiativ, weil ich nochmals einen anderen Gedanken habe, mit der KL alleine zu sprechen und zuversichtlich, weil das klappen sollte. Ich fühle mich genervt und unmotiviert, lustlos die Diskussion weiterzuführen, frustriert und hilflos, weil ich mich in einer Sackgasse befinde und die zwei sich gegen mich spannen.
- Kognition PSA: „kein Bock“ „Was soll ich machen?“ „Was jetzt – bleibe ich weiterhin lieb und verständnisvoll?“ „Toll, ich bin in einer Sackgasse.“ „Ich habe mich selbst in diese Sackgasse hineinmanövriert.“
- Beobachterin:
- BW und KL lehnen gegen vorne, sind mehr zueinander gerichtet, haben viel Blickkontakt.
PSA hat weiterhin eine aufrechte Körperhaltung, gestikuliert viel, hat eine klare und bestimmte Stimme. - BW und KL lehnen gegen vorne, sind mehr zueinander gerichtet, haben viel Blickkontakt.
- PSA hat weiterhin eine aufrechte Körperhaltung, gestikuliert viel, hat eine klare und bestimmte Stimme.
Fünfte Sequenz: PSA holt PA aufgrund Aussichtslosigkeit
„Der PSA gehen die Argumente sowie die Handlungsmöglichkeiten aus. Da die PSA die KL zudem gut verstehen kann, hat die PSA keine Motivation mehr sie zu drängen. Die PSA holt die PA zur Hilfe und schildert ihr zuvor kurz die Situation. Als die PA dazu kommt, meint sie bestimmt mit forschem Ton, dass es nichts zu diskutieren gäbe und dass die PSA und die KL jetzt einfach losgehen sollen. Weder die KL noch die andere Bewohnerin widersprechen ihr. Die KL und die PSA gehen zusammen aufs Tram.“
Reflection in Action:
- Emotion KL: Ich fühle mich überrumpelt, aufgrund des anderen Umgangstons der PA im Vergleich zum vorherigen der PSA. Auch weil klare Ansage und kein Raum für Diskussion. Ich fühle mich entwaffnet, weil kein Raum mehr für Mitbestimmung oder Mitgestaltung besteht. Ich fühle mich widerstandslos, weil klar ist, dass ich gehen muss und ich habe kein Bedürfnis mehr zu argumentieren.
- Emotion BW: Ich fühle mich ignoriert, weil niemand auf mich eingeht oder reagiert in der Situation und ich nicht mehr relevant zu sein scheine. Ich fühle mich irritiert, weil die KL einfach ihren Widerstand aufgibt. Ich fühle mich perplex aufgrund des schnellen Situationswechsels und „Beziehungsabbruchs“.
- Emotion PA: Ich fühle mich genervt, da ich schon wieder intervenieren muss. Ich fühle mich angespannt, da ich die Situation aufgrund des Zeitdrucks schnell auflösen will. Ich fühle mich helfend, da ich die PSA unterstütze. Ich fühle mich klar und ruhig, weil ich weiss, was zu tun ist und wie ich handeln muss. Ich fühle mich verständnislos, weil ich nicht verstehe, weshalb sie diskutieren/was es zu diskutieren gibt. Ich fühle mich ein wenig gestresst, weil ich neu in der Situation bin und aufgrund des Zeitdrucks.
- Emotion PSA: Ich fühle mich klein, weil ich Hilfe holen muss. Ich fühle mich erleichtert und dankbar über das Verständnis der PA und dass ich mich aus der Situation nehmen kann. Ich fühle mich aufgewühlt und unruhig über das Auflösen der Situation. Ich fühle mich verunsichert über den weiteren Verlauf mit dem Arztbesuch. Ich fühle mich überfordert und irritiert, weil die Situation der Auflösung so schnell geschah. Ich fühle mich übergangen und überrollt von der Handlung der PA gegenüber der KL und mir. Ich fühle mich nicht gestärkt von der PA, weil sie mir auch keine Option für ein anderes Mal vorgelebt hat.
- Kognition PSA: „Toll, ich bin in einer Sackgasse.“ „Ich habe mich selbst in diese Sackgasse hineinmanövriert.“ → überschneidend mit S4. „Bin ich eine Versagerin, denn es wäre ja eine so einfache Situation?“ „Das ist übergriffig, das ist eine Machtausübung!“ „Das ist eine scheiss Situationsauflösung.“ „Was nun? Wie kann ich die Beziehung wieder aufbauen?“ „Hätte ich härter/bestimmter sein müssen?“
- Beobachterin:
- Der Oberkörper der PA ist nach vorne gelehnt. Ihr Gesicht ist ernst, ihr Tonfall laut und bestimmt. Die PA gestikuliert mit ihrem Zeigefinger in der Luft.
- PSA und KL haben überraschte Gesichter.
- BW schaut verwirrt.
- KL zögert, bevor sie losläuft.
- PSA macht eine einladende Handbewegung und ihr Ton ist wohlwollend und ruhig.
5.1 Erklärungswissen – Warum handeln die Personen in der Situation so?
Warum können sich PSA und KL nicht einigen?
5.1.1 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch
Thierschs Ansatz zur Lebensweltorientierung betont, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die Erfahrungen zu berücksichtigen, die Menschen in ihrer Lebenswelt machen, um sie wirklich zu verstehen (vgl. Thiersch/Otto 2020: 9). Die lebensweltorientierte Soziale Arbeit betrachtet Menschen in ihrer Komplexität, ohne sie zu stigmatisieren (vgl. ebd.: 89).
Die Situation lässt sich in der Lebenswelt Jugendheim verorten. Die Tätigkeiten im Jugendheim zeichnen sich aus durch die Gestaltung des Raums, die Strukturierung der Zeit und die Verlässlichkeit der Versorgung (vgl. ebd.: 175). In der Lebenswelt Jugendheim ist entscheidend, dass die Fachkräfte den Kontakt zu anderen Lebenswelten der Jugendlichen fördern, um die Entstehung isolierter Lebenswelten zu vermeiden. Dazu gehören insbesondere die Schule, Freizeitaktivitäten, die Nachbarschaft sowie die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit ihren Erfahrungen und Beziehungen, wie Freundschaften und Familienbindungen, zu der Welt, aus der sie kommen (vgl. ebd.: 177). Die Umsetzung dieser dargestellten Möglichkeiten und Forderungen zur Gestaltung des Alltags wird in der Realität massgeblich durch die institutionellen Rahmenbedingungen des Heims beeinflusst und oft beeinträchtigt (vgl. ebd.: 176).
Die Auseinandersetzung mit der Lebensgestaltung ist stets geprägt von psycho-physischen Ressourcen, materiellen Bedingungen und Machtverhältnissen, die durch Faktoren wie poverty, gender und race bestimmt sind (vgl. ebd.: 50). In einer Welt mit begrenzten Ressourcen und geprägt von sozialen sowie genderspezifischen Machtstrukturen geraten Menschen oft in Spannungen und Orientierungsprobleme. Die Übergänge zwischen verschiedenen Lebenswelten können Sicherheiten und Orientierung in Raum und Zeit beeinträchtigen. Einige reagieren mit Widerstand und werden trotzig oder aggressiv, während andere sich überfordern und Ängste erleben, was zu kontraproduktiven Bewältigungsstrategien führen kann (vgl. ebd.: 89).
Relationierung
Die institutionellen Rahmenbedingungen umfassen die Kooperationsbereitschaft der KL, die Obhutspflicht der Institution und individuell festgelegte Regelungen (siehe Abschnitte 3, 5.4 und 5.6). Die KL erfüllt die Bedingung der Kooperation teilweise. Die Bereitschaft zur Kooperation zeigt sich darin, dass die KL zur vereinbarten Zeit bereitsteht, auf die PSA wartet und mit ihr in den Austausch geht. Sich zu weigern oder sich nicht einig zu sein, widerspricht dem Grundsatz der Kooperation nicht, solange der Kontakt aufrechterhalten bleibt, was in der Situation der Fall ist. Die Herausforderung entsteht insbesondere dann, wenn die KL sich weigert, die Vereinbarung zur Terminbegleitung einzuhalten. Trotz der Erklärungen der PSA, weshalb die Begleitung wichtig ist, können sich die PSA und die KL nicht einigen, da die KL standhaft in ihrer Meinung und Argumentation bleibt. Dadurch kann die Institution nicht sicherstellen, dass sie über alle relevanten Gesundheitsinformationen verfügt und kann somit ihrer Pflicht und Verantwortung gegenüber der KL nicht nachkommen.
Die zeitlichen und personellen Ressourcen sind vorgegeben und begrenzt. Es besteht ein Zeitdruck, der vor allem die Handlungen der PSA und der PA beeinflusst. Zudem kommt es nicht in Frage, dass eine andere sozialpädagogische Fachkraft die KL zum Termin begleitet. Der durch den Zeitdruck entstehende Stress kann dazu führen, dass sich beide Seiten nicht vollständig auf das Gegenüber einlassen können. Mehr dazu im Kapitel 5.6.
Weitere relevante Ressourcen sind die psycho-physischen Bedingungen der KL. Ihre mentalen Fähigkeiten, emotionale Stabilität, ihr Selbstvertrauen, ihre Motivation, ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihre energetische Ausdauer haben einen Einfluss auf die Situation. Physische Bedingungen, die ihre Leistungsfähigkeit zusätzlich beeinflussen können, sind ihr körperlicher Gesundheitszustand, ihre Ernährung und ihr Schlaf. Das Selbstvertrauen der KL scheint in der Situation durch die Bestärkung der BW gestärkt zu werden, da sie in ihrer Körpersprache selbstsicher wirkt, insbesondere in Momenten, in denen sie Zuspruch von der BW erhält. Sich der Abmachung zu widersetzen und von der BW unterstützt gegen die Argumente der PSA vorzugehen, scheint die Motivation zu erhöhen, für sich selbst einzustehen und sich dadurch selbstwirksam zu fühlen. Die Problemlösungsfähigkeiten der KL scheinen in der Situation eher einfältig und wirken kompromisslos, da sie auf ihrer Meinung beharrt und dieselben Argumente mehrmalig wiederholt. Auch frühere Konfliktsituationen zeigen, dass es der KL schwerfällt, Argumente und Gedanken von professionellen Fachkräften bzw. generell Erwachsenen nachzuvollziehen und auf diese einzugehen. Die energetische Ausdauer ist anspruchsvoll festzulegen. Eine Möglichkeit diese zu erkennen wäre den Zeitpunkt zu eruieren, sobald die KL emotionaler wird und sich Anzeichen von Frustration und Stagnation zeigen. In diesem Fall geschieht dies im Moment, in dem die KL sowie die PSA ihre Argumente geteilt haben, sie zu keiner Einigung gekommen sind und aufgrund dessen eine Ungeduld seitens beider Parteien entsteht. Da es sich in der Situation jedoch nur um wenige Minuten handelt, hat der Faktor „energetische Ausdauer“ womöglich keinen grossen Einfluss. Auch die emotionale Stabilität der KL lässt sich in der Situation selbst nicht klar bewerten. Bekannt ist eine grundsätzliche emotionale Instabilität, die auf die Pubertät, ihre Bindungsstörung, ihre depressiven Episoden sowie auf den Verdacht einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zurückzuführen ist. Womöglich hat dies einen bedingten Einfluss auf ihre Fähigkeit, mit der PSA eine positive Beziehung aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten und auf die Beeinflussbarkeit ihrer Meinung durch die Bestärkung der BW. Ihre physischen Ressourcen haben wohl auch nur am Rande einen Einfluss auf die Situation.
Zu den materiellen Bedingungen gehören die Transportmittel, finanzielle Ressourcen und die Krankenkassenkarte. Der Weg zum Gynäkologen erfordert einen Fussweg von der Institution zur Tramhaltestelle von etwa drei Minuten, eine Fahrt mit dem Tram und anschliessend mit dem Zug von insgesamt über 30 Minuten sowie einen Fussweg vom Bahnhof zur Arztpraxis von etwa zehn Minuten. Die Durchführung des Transports mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) ist festgelegt, da sie für dieses ÖV-Netz ein Abonnement hat, da das Institutionsauto nicht zur Verfügung steht aufgrund des Lernfelds für die KL. Grundsätzlich hat die KL die Fähigkeit, sich eigenständig mit den ÖV fortzubewegen, jedoch hat es sich für sie als verlockend herausgestellt, direkt nach dem Gynäkologie-Termin zu ihrem Vater nach Hause zu gehen, da der Weg dorthin deutlich kürzer ist als der Weg zurück in die Institution. Neben den finanziellen Ressourcen des ÖV-Tickets gibt es Budget für die Verpflegung für den Termin. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit sich im Vorfeld in der Institution zu verpflegen oder etwas für den Termin mitzunehmen.
Dass die KL nicht von der PSA begleitet werden möchte, könnte auf ein Machtverhältnis zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass die KL sich unwohl fühlt, von der PSA begleitet zu werden, weil sie sich in einer abhängigen Position oder unter Druck gesetzt fühlt. Dass eine bestimmte Form von Macht besteht, ist unbestreitbar. Die PSA befindet sich in der Verantwortung gegenüber der KL. Auch ist die PSA in der Position Konsequenzen oder Sanktionen auszusprechen. Daher ist die KL bis zu einem gewissen Grad abhängig von der PSA. Die PSA steht in der Verantwortung sich diesem Machverhältnis bewusst zu sein, dieses zu reflektieren und es nicht auszunutzen. Der Umgang damit kann einen grossen Einfluss auf die Beziehung zur KL haben.
Der PSA muss bewusst sein, dass Übergänge zwischen verschiedenen Lebenswelten Spannungen bei der KL auslösen können. Da der Gynäkologe, als Freund der Familie der KL schon vor dem Heimaufenthalt Teil ihrer Lebenswelt war, bestehen zu ihm und der Arztpraxis bereits Assoziationen. Der Wechsel der Umgebung und das „Eindringen“ der PSA in den vertrauten Raum der Arztpraxis können die KL verunsichern. Bisher wurde die KL von ihrem Vater oder ihrem Freund zum Gynäkologen begleitet. Die Erwartungen, neue (soziale) Regeln sowie Veränderungen zeitlicher und räumlicher Bedingungen beim Verlassen der Lebenswelt Jugendheim und Betreten der bekannten Lebenswelt der Arztpraxis können bei der KL zu inneren Spannungen führen. Es kann irritierend sein und zu Verwirrung und Stress führen, dass das Vertrauensverhältnis zum Gynäkologen im Vergleich zum noch aufzubauenden Verhältnis zur PSA enger ist. Die KL könnte sich unsicher fühlen, wie sie sich gegenüber der PSA verhalten soll, insbesondere in einem so persönlichen und vertrauten Umfeld wie der Arztpraxis.
Die Haltung der KL bezüglich der Begleitung durch die PSA, wird durch ihre psycho-physischen Bedingungen, die materielle Situation und das Machtverhältnis beeinflusst. Die spezifische Kombination dieser Faktoren verursacht möglicherweise die Uneinigkeit.
5.1.2 Konzept der Identitätsphase nach Erik Erikson
Psychosoziale Entwicklung der Identität und die Integration von Grundhaltungen:
Erik Erikson beschreibt acht Lebensphasen, welche die Identität eines Menschen prägen. Diese Identitätsbildung wird als eine Abfolge von phasenspezifischen Krisen betrachtet, welche auch Kernkonflikte genannt werden. In jeder phasenspezifischen Krise zeigt sich ein kritischer Höhepunkt, welcher dann zu einer bleibenden Lösung führt und die Ich-Bildung beeinflusst und prägt (vgl. Abels/König 2016: 96).
Nach Erikson beginnt die bedeutsamste Phase der Identitätsbildung im Jugendalter, der sogenannten Adoleszenz, die der fünften Lebensphase zugerechnet wird. Die Adoleszenzphase ist geprägt von der Loslösung der Kindheit und dem Wandel ins Erwachsenenalter. Das Finden neuer Bezugspersonen, das Lösen von alten Beziehungen sowie die Neubewertung alter Orientierungen und körperliche Veränderungen prägen die Adoleszenz.
Die Identitätsfindung bzw. Identitätsdiffusion stellt den Kernkonflikt dieser Entwicklungsphase dar. Mit der Adoleszenz geht eine Phase des Zweifelns und des Übergangs einher (vgl. ebd.: 98). In dieser Phase können Jugendliche obsessiv darauf bedacht sein, herauszufinden, wie sie sich in den Augen anderer und vor allem der eigenen Peergroup im Vergleich zum eigenen Selbstgefühl präsentieren. Dieser fast zwanghafte Vergleich findet statt, um eine zuverlässige Identität zu bilden, und zeigt sich in der ruhelosen Erprobung von Werten und Möglichkeiten. Wo sich die neu gewonnene Selbstdefinition aus kollektiven oder persönlichen Gründen als zu herausfordernd zeigt, entsteht ein Gefühl der Rollenkonfusion. Wie oben bereits erwähnt, ist die Ablösung von alten Bezugspersonen Teil dieses Entwicklungsschritts. Diese Ablösung kann sich durch direkte Konfrontation und Ablehnung gegenüber den betreffenden Bezugspersonen zeigen (vgl. ebd.: 99).
Die Peergroup, also die Freunde, sind in der Adoleszenzphase sehr wichtig, da sie neue Sichtweisen, Orientierungen und Bezugspersonen darstellen können. Da sich die Peergroup ebenfalls im Identitätsfindungsprozess befindet, kann dies jedoch auch zu mehr Unsicherheit beim Individuum führen. Rigorismus zeigt sich in der absoluten Inklusion oder Exklusion einer Identität. Schutzmechanismen der Abwehr und Abgrenzung stellen den Versuch dar, eine gerade entworfene Identität aufrechtzuerhalten und somit eine Rollendiffusion zu verhindern. Mit dieser klaren Abgrenzung und Zuordnung wird das Prinzip der Treue ausgebildet, das sich als feste Verpflichtung auf Ideale und Personen zeigt (vgl. ebd.: 100).
Relationierung
Adoleszenz:
Die Bewohnenden der sozialpädagogischen Institution befinden sich in der fünften Entwicklungsphase der Adoleszenz und sind mit der Herausforderung des Übergangs ins Erwachsenenalter konfrontiert.
Loslösen von alten Beziehungen und Hinwenden zu neuen Bezugspersonen:
In der Adoleszenz ist die Loslösung von alten Beziehungen ein wichtiges Element der Entwicklung. In der Organisation stellen die Professionellen der Sozialen Arbeit Bezugspersonen dar, von denen sich die Jugendlichen in der Adoleszenzphase möglicherweise lösen möchten. In der beschriebenen Situation zeigt sich diese Loslösung von alten Beziehungen und Hinwendung zu neuen Beziehungen durch den Wunsch der KL, ohne die PSA zum Termin zu gehen. Sie möchte den Termin entweder selbstständig oder mit der BW, die in der Situation neben ihr steht, wahrnehmen. Die Hinwendung zu neuen Bezugspersonen zeigt sich insbesondere in dieser Situation, da die KL die BW als Freundin bezeichnet und mit ihr zum Termin gehen möchte, obwohl die KL und die BW noch keinen engen Kontakt miteinander haben.
Die Loslösung von Bezugspersonen erfordert Trennungsenergie, die sich durch nicht konformes Verhalten und offenen Widerstand zeigen kann. In der beschriebenen Situation zeigt sich der offene Widerstand der KL durch deren direkte Äusserung, ohne die PSA zum Termin zu gehen, und durch die Verweisung auf ihre eigene Privatsphäre sowie den Ausschluss der PSA aus dieser. Diese Situation verdeutlicht, dass der Versuch der KL, sich von der alten Bezugsperson, in diesem Fall die PSA, zu distanzieren, eine Ursache dafür sein kann, dass sich PSA und KL nicht verstehen.
Identitätsfindung:
Das Streben nach Autonomie, das einer eigenen Identität zugrunde liegt, zeigt sich in der Situation der ersten Sequenz deutlich durch die abwehrende Haltung der KL und der BW gegenüber der PSA und der klaren Absicht der KL, ohne die PSA zum Termin zu gehen. Dass die KL bereits bereitsteht, um loszugehen, erstaunt die PSA und verdeutlicht gleichzeitig den Autonomiewunsch der KL. Ihre Pünktlichkeit könnte darauf hinweisen, dass die KL der PSA zeigen will, dass sie in der Lage ist, den Termin eigenständig und ohne Unterstützung wahrzunehmen. Die KL fühlt sich in ihrem Widerstand gegenüber der PSA kongruent mit ihrer selbstsicheren Identität, in der sie unabhängig von der PSA zum Termin gehen kann. Die Frage „Wer bin ich und wer bin ich nicht?“ scheint in diesem Moment für die KL klar beantwortbar. Die KL fühlt sich durch die Abgrenzung zur PSA selbstbestimmt und stark. In dieser Sequenz ist sie nicht jemand, der macht, was andere bestimmen. Durch die Unterstützung der BW ist sie zudem nicht alleine.
Wichtigkeit der Peergroup:
In dieser Situation bildet die BW die Peergroup der KL. Die KL und die BW orientieren sich am Verhalten der jeweils anderen, was eine Wechselwirkung erzeugt. Das gemeinsame Ritual des Rauchens stärkt ihre Verbindung, während ihre ablehnende Haltung gegenüber der PSA Sicherheit und Abgrenzung bietet. Diese Abgrenzung fördert die Bildung einer gemeinsamen Identität. Die KL grenzt sich deutlich ab und lehnt die Vorschläge der PSA strikt ab, wobei sowohl sie selbst als auch die BW Mechanismen der Abwehr und Abgrenzung gegenüber der PSA anwenden. Dies kann als Rigorismus interpretiert werden, da keine Flexibilität in der Zusammenarbeit mit der PSA gezeigt wird und deren Ideen entschieden zurückgewiesen werden.
Vergleich zu Peergroup:
Diese selbstsichere Identität der KL wird in der ersten und zweiten Sequenz gefestigt, da sie sich selbst in den Augen der BW sieht und sich durch ihre klare Entscheidung vor einer Peerperson behaupten und ihre neue Identität präsentieren kann.
Identitätsdiffusion und Rollenkonfusion:
In der fünften Sequenz gibt es möglicherweise Hinweise auf eine Identitätsdiffusion der KL, da sich ihre gewonnene Selbstdefinition aufgrund der Handlungsweise der PA als nicht durchführbar zeigt und sie trotz ihres Widerstands gegenüber der PSA die Anordnung der PA befolgt und ihren Widerstand direkt aufgibt. Dies zeigt sich auch in der Reaktion der BW, welche durch den sofort aufgegeben Widerstand der KL irritiert ist und sich unter anderem von ihr ignoriert fühlt.
5.1.3 Neue Autorität nach Heim Omer
Mit dem Konzept der Neuen Autorität nach Heim Omer wird Autorität neu definiert, um den eher negativ assoziierten Autoritätsbegriff neu zu verstehen. Heim Omer differenziert zwischen der traditionellen Autorität und der Neuen Autorität, deren Grundprinzip die bedingungslose Präsenz ist, mit der auch in schwierigen Situationen die professionelle Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Mit Präsenz ist die Ausstrahlung gemeint, womit der Klientel signalisiert wird: „Ich bin da und bleibe da. Ich bleibe auch da, wenn es unangenehm wird.“ Mit dem Prinzip der entschlossenen Präsenz, Anteilnahme und Fürsorge wird das traditionelle Verständnis von Autorität, das oft mit hierarchischer Struktur, Dominanz und Kontrolle assoziiert wird, transformiert (vgl. Omer/Haller 2020: 23f.).
Klient:innen spüren die physische und mentale Anwesenheit der Professionellen der Sozialen Arbeit und nehmen sie daher als wachsam und entschlossen im Umgang mit Problemen wahr (vgl. ebd.: 25).
In der neuen Autorität wird mit bedingungsloser Präsenz sowie mit Beharrlichkeit und Widerstand gegen negative Verhaltensmuster vorgegangen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Reaktionsmöglichkeiten und Sanktionierungsmöglichkeiten der PSA und der Erweiterung von Reaktionsmöglichkeiten anstelle von Sanktionierungsmöglichkeiten (vgl. Omer/von Schlippe 2016: 207).
In der Neuen Autorität wird mit bedingungsloser Präsenz sowie mit Beharrlichkeit und Widerstand gegen negative Verhaltensmuster gearbeitet. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Reaktionsmöglichkeiten und Sanktionierungsmöglichkeiten der PSA und der Erweiterung von Reaktionsmöglichkeiten anstelle von Sanktionierungsmöglichkeiten (vgl. Omer/von Schlippe 2016: 207).
Heim Omer beschreibt das Prinzip der Ankerfunktion der Eltern für ihre Kinder. Dieses Konzept übertragen wir auf das professionelle pädagogische Umfeld, wo die PSA eine vergleichbare Ankerfunktion einnimmt. Die Ankerfunktion definiert einen klaren Rahmen, der den Jugendlichen Sicherheit und Stabilität vermittelt. Um diese Rolle erfolgreich auszufüllen, müssen Fachkräfte selbst gut verankert und von ihrer eigenen Wirksamkeit überzeugt sein. Wesentliche Elemente einer starken Ankerfunktion, die erlernbar sind, umfassen Struktur, Präsenz, aufmerksame Fürsorge, Unterstützung, Selbstkontrolle und Deeskalation (vgl. Omer/Streit 2019: 18).
Präsenz als Netzwerk: Die Präsenz kann mit der Vernetzung der PSA mit anderen PSA und dem Team stärker gewährleistet werden und ein Wir anstelle vom Einzelkampf darstellen. Die Teamarbeit kann sich durch die Neuformulierung von “ich will, dass du dies tust” zu “wir wollen, dass du dies tust” ausdrücken (vgl. Omer/Haller 2020: 26). In der neuen Autorität wird dazu ermutigt, sich für ein Problem die Hilfe anderer zu suchen, auch wenn das Problem allein gelöst werden könnte (vgl. Omer/von Schlippe 2016: 208).
Relationierung
In der ersten Sequenz der Reflection in Action wird die entschlossene Präsenz der PSA sichtbar, indem sie zuversichtlich auf die KL zugeht und direkt fragt ob die KL bereit ist zum Termin loszugehen. Da die KL bereitsteht und die letzte Begleitung einwandfrei ablief, kann davon ausgegangen werden, dass die PSA die Erwartung hat, direkt zum Termin losgehen zu können. Die Ankerfunktion der PSA und deren Präsenz scheint erstmals durch den Kontakt mit der KL ins Wanken zu kommen, als sie diese mit einer anderen Bewohnerin beim Rauchen antrifft. Die PSA scheint durch die Anwesenheit der BW etwas irritiert zu sein, da diese bei der Arbeit sein sollte und die PSA sie äusserst selten zusammen gesehen hatte. Auch scheint die PSA darüber erstaunt zu sein, dass die KL bereits aufbruchsbereit ist.
Der Widerstand der KL gegen die Begleitung durch die PSA, scheint die PSA bei der Umsetzung des Auftrags zu verunsichern. Daraus lässt sich ableiten, dass die PSA ihre entschlossene Präsenz teilweise gegenüber der KL durch deren Widerstand verliert. Die PSA möchte auf die KL und deren Argumente eingehen, steht jedoch unter Zeitdruck und der Verantwortung die KL pünktlich zum Termin zu begleiten. Durch den Zeit- und Erwartungsdruck, den Auftrag der Institution selbständig zu erfüllen, scheint die PSA an mentaler Präsenz zu verlieren. Sie fühlt sich angespannt und befindet sich in einem inneren Konflikt. Aufgrund der Bedeutung des Widerstands für die KL, der laut Omer zur Bildung der Identität beiträgt, und weil es der PSA ein Anliegen ist, eine empathische Haltung gegenüber der KL zu bewahren, möchte die PSA auf den Widerstand der KL eingehen.
Die KL strebt in dieser Situation danach, ihre Autonomie zu wahren, was den professionellen Entwicklungszielen entspricht. Gleichzeitig versucht die PSA die Regeln durchzusetzen, was aufgrund zunehmender Diskussionen immer schwieriger wird.
Die KL und PSA haben Schwierigkeiten sich in dieser Situation zu einigen, da die PSA teilweise ihre mentale Präsenz und selbstsichere Haltung verliert. Dadurch fehlt es der PSA an natürlicher und gelassener Autorität, die Raum für Widerstand bietet und gleichzeitig Klarheit über die Durchführung des Auftrags schafft. Für die KL könnte ein „Nachgeben“ bzw. Einlenken gegenüber den PSA einen Gesichtsverlust bedeuten.
Die PSA nimmt die Ankerfunktion wahr, indem sie empathisch Verständnis für den Widerstand der KL zeigt und dabei die Rahmenbedingungen in der dritten Sequenz klar erklärt. Hierbei argumentiert sie die Wichtigkeit der Begleitung und betont die positive Intention der Unterstützung sowie das Ziel des Beziehungsaufbaus zwischen der PSA und der KL.
Auf den Aspekt der Vernetzung geht die PSA in der dritten Sequenz ein, indem sie in der Wir-Form argumentiert und somit der Teamarbeit Ausdruck verleiht. Auch in der fünften Sequenz zeigt sich der Aspekt der Vernetzung seitens der PSA, indem sie sich Unterstützung durch ihre PA holt. Die PA scheint den Aspekt der Vernetzung insofern nicht wahrzunehmen, als dass sie keine Handlungsmöglichkeiten mit der PSA bespricht, sondern den Auftrag alleine mit traditioneller Autorität und Einsatz ihrer Machtposition durchsetzt. Die PA wendet Macht an, indem sie einen lauten und bestimmten Tonfall wählt, den Zeigefinger erhebt, sich mit ihrer Körperhaltung nach vorne lehnt und formuliert, dass kein Widerspruch geduldet wird. Die PA verwehrt somit der PSA die Möglichkeit, sich mit ihr zu vernetzen. Sie erfüllt ihre Aufgabe nicht, die PSA zu empowern und mögliche Handlungsmöglichkeiten zu besprechen, um diese Konfliktsituation im Team professionell lösen zu können. Sie lässt die PSA in einer Ohnmachtsposition gegenüber der KL und untergräbt somit deren Autorität. Aus Sicht der PA kann es scheinen, als hätte sie der PSA eine Handlungsmöglichkeit durch ihr Verhalten aufgezeigt. Das Untergraben der Autorität der PSA durch die PA kann dazu führen, dass die KL die PSA weniger ernst nimmt und oder das Vertrauen zu ihr gefährdet wird.
5.1.4 Gruppendynamik
Gruppenpolarisierung nach Leon Festinger:
Mit Bezug auf den Verfasser Leon Festinger, stellt das Buch „Sozialpsychologie – Der Mensch in sozialen Beziehungen: Interpersonale und Intergruppenprozesse“ fest, dass eine Gruppe nach einer Diskussion eine extremere Position einnimmt als die ursprünglichen Meinungen ihrer Mitglieder, was als Gruppenpolarisierung bezeichnet wird. Das bedeutet also, dass sich die Einzelmeinungen der Gruppenmitglieder im Verlauf der Diskussion extremisieren. (vgl. Werth et al. 2020: 206f.)
Eine mögliche Ausprägung der Extremisierung ist, wenn die Gruppe eine grössere Risikobereitschaft zeigt als ihre Mitglieder durchschnittlich. Die Extremisierung und somit auch die Verschiebung der Meinung ist umso grösser, je extremer die Ursprungsmeinungen vor der Diskussion waren. Die Einigung auf eine gemeinsame Position in der Gruppe führt meist dazu, dass die individuelle Meinung und Einstellung danach stärker dem Gruppenkonsens entsprechen. (vgl. ebd.: 207)
Folgende Mechanismen führen zu der Meinungsverschiebung ins Extrem im Verlauf einer Diskussion (vgl. ebd. 2020: 207f.):
- Je öfter Meinungen in einer Gruppe geäussert und von anderen Mitgliedern aufgegriffen werden, desto extremer werden sie.
- Die Mitglieder tendieren grösstenteils in die Richtung, die aufgrund der Gruppennormen positiv bewertet wird. Neue Argumente können vorhandene Meinungen verstärken und zur Extremisierung beitragen.
- Menschen neigen dazu, ihre Meinungen mit anderen zu vergleichen und dabei positiv abzuschneiden. In Gruppendiskussionen kann die Tendenz bestehen, einen noch extremeren Standpunkt einzunehmen, um sich als mutige:r Vordenker:in zu profilieren. Dies kann zu einer Extremisierung der Gruppenmeinung führen, insbesondere wenn die Mitglieder stark mit der Gruppe identifiziert sind. Selbst ohne Diskussion kann die Identifikation mit der Gruppe zu einer Polarisierung der Meinungen führen. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn die Gruppenmitglieder wenig voneinander wissen. Insgesamt führt Gruppenpolarisierung zu extremen Entscheidungen, die über die individuelle Neigung hinausgehen. Dies kann positive Effekte haben, wie ein verstärktes Engagement für gemeinsame Ziele, aber auch negative, wie übermässige Risikobereitschaft in bestimmten Situationen, wie beispielsweise beim Fahren.
Deindividuierung (Deindividuation) nach Leon Festinger:
Deindividuierung tritt nach Festinger auf, wenn die soziale Identität einer Person wichtiger wird als die persönliche Identität. Dies kann dazu führen, dass normale Verhaltensbeschränkungen aufgehoben werden und aggressives Verhalten verstärkt wird, um den aktuellen Gruppennormen zu entsprechen (vgl. Werther et al. 2020: 358f.).
Bestimmte situative Gegebenheiten wie Menschenmassen, Masken, Uniformen oder Dunkelheit senken die Erkennbarkeit und steigern die Anonymität eines Individuums, was zur Deindividuation führt. Das Verhalten des Individuums wird dann durch den Anstieg gruppenspezifischer Normen und die Abnahme des Gefühls persönlicher Verantwortung beeinflusst. Gesellschaftliche Normen werden weniger wichtig, als die Normen der aktuellen Gruppe. Ob dies zu aggressivem Verhalten führt, hängt vom Inhalt der Gruppennormen ab. Wenn diese Gewalt unterstützen, wird aggressives Verhalten durch Deindividuierung wahrscheinlicher; wenn sie jedoch friedliches Verhalten fördern, kann Deindividuierung auch prosoziales Verhalten begünstigen (vgl. ebd.: 360).
Gruppendenken nach Irving Janis:
Nach Janis besagt die Theorie des Gruppendenken, dass ein ungesundes Streben nach Konsens für die schlechte Qualität der Entscheidungen verantwortlich ist, was fatale Fehler und Konsequenzen nach sich zieht. Jedoch konnten wichtige Annahmen dieser Theorie nicht bestätigt werden. Stattdessen können die Symptome des Gruppendenkens als Ergebnis verschiedener ungünstiger Einflüsse auf Gruppenentscheidungen betrachtet werden, wie z.B. der normative Einfluss, Unterordnung unter Autoritäten, die Gruppenpolarisierung oder der Effekt des gemeinsamen Wissens, was bedeutet, dass hauptsächlich Informationen diskutiert werden, die bereits vorher allen Gruppenmitgliedern bekannt waren und einzigartiges Wissen vernachlässigt wird (vgl. Werther et al. 2020: 209f.).
Zentrale Variablen der Theorie des Gruppendenken sind die gefühlte Bedrohung von aussen oder die persönlichen Risiken, die als Teil der Gruppe als zu optimistisch eingeschätzt wird. Diese Faktoren können die Entscheidungsprozesse beeinträchtigen, weil Menschen dazu neigen, potenzielle Gefahren zu ignorieren oder zu leugnen, besonders wenn sie sich in einer Gruppe befinden (vgl. ebd.: 210).
Relationierung
Es ist wichtig klarzustellen, dass die Theorie auf die Situation anwendbar ist, selbst wenn von einer Gruppe gesprochen wird, obwohl nur die KL und die BW zu zweit sind. Die „Gruppe“, auf die sich die Theorie bezieht, bezeichnet lediglich die KL und die BW, nicht jedoch die PSA. Wichtig zu erwähnen ist, dass die beschriebenen Gruppentheorien nur teilweise auf die Situation zutreffen, da sich die Gruppendynamik nicht lange einpendeln konnte. Die KL und die BW kennen sich nicht besonders gut, verbringen wenig Zeit miteinander und waren zudem nur zu zweit. Die Gruppentheorien beziehen sich eher auf grössere Gruppen. Es scheint, als habe die KL der BW vor der Begegnung mit der PSA klargemacht, dass sie sich nicht von ihr begleiten lassen wolle. Dies war wohl kaum eine lange oder ausführliche Diskussion, da die BW grösstenteils die Argumente der KL unterstützte und keine eigenen zusätzlichen Argumente einbrachte.
Nichtsdestotrotz hätte durch das Absprechen des Vorgehens zwischen der KL und der BW im Vorhinein eine Gruppenpolarisierung entstehen können. Es scheint, dass sich die KL mit der Gruppe identifizieren kann, da sie und die BW in der gleichen Position als Heimbewohnerinnen sind. Auch ein Gruppendenken scheint insofern entstanden zu sein, als die PSA als gefühlte Bedrohung von aussen wahrgenommen werden kann. Durch das Gefühl, von der BW in ihrer Meinung unterstützt zu werden und sich dadurch stark zu fühlen, kann es dazu führen, dass die KL die persönlichen Risiken bzw. die persönlichen Konsequenzen nicht objektiv einschätzen kann. Dies betrifft vor allem die langfristigen Konsequenzen, da Abmachungen und Sanktionen bei Nichteinhaltung vereinbart wurden.
Das wiederholte Vorbringen gewisser Argumente hat zur Extremisierung und Verhärtung der Meinungen beigetragen. Diese Extremisierung und die daraus resultierende zunehmende Entfernung der Meinungen zwischen der KL und der PSA könnten dazu geführt haben, dass keine Einigung erzielt werden konnte. Das Gruppendenken hat möglicherweise auch die Entscheidungsfindung der KL beeinflusst, da sie sich in der Unterstützung durch die BW sicher fühlte und weniger offen für die Argumente der PSA war. Insgesamt hat die Unterstützung durch die BW die Standhaftigkeit der KL verstärkt und eine kompromisslose Haltung gefördert, was die Uneinigkeit weiter verstärkte.
Deindividuierung: In der Situation scheint der KL die soziale Identität wichtiger zu sein als die individuelle Identität. Das bedeutet, dass die KL stärker dazu tendiert sich an den Normen der Gruppe zu orientieren und weniger nach ihren eigenen, individuellen Überzeugungen handelt. In diese Situation könnte die Gruppennorm darin bestehen, eine bereits vorab besprochene Meinung standhaft zu vertreten und den eigenen Willen durchzusetzen, mit dem Ziel des selbstbestimmten Handelns. Eine Gruppennorm könnte jedoch auch darin bestehen, dass die KL und die BW beschlossen haben, sich aktiv gegen die PSA zu stellen. Wenn sie dies als ihre Aufgabe ansehen, wird es für die KL schwierig, sich von dieser Norm oder Aufgabe zu lösen, ohne sich als Verräterin gegenüber der Gruppe zu fühlen.
Im Gegensatz dazu könnte die individuelle Identität der KL, abgeleitet von ihrem Verhalten in anderen Situationen, darin bestehen, zuzuhören, auf die PSA einzugehen und sich gegebenenfalls auch umstimmen zu lassen. Im Einzelgespräch besteht nicht die Gefahr, von der Gruppennorm abweichen zu müssen, um auf das Gegenüber eingehen zu können.
Aus verschiedenen Erfahrungen, die die PSA mit der KL im Einzelgespräch gemacht hat, lässt sich ableiten, dass die PSA die Verhärtung in der Meinung der KL auf die Dynamik zwischen der KL und der BW zurückführt. Daher hat die PSA versucht, die beiden räumlich zu trennen, um die Diskussion zu deeskalieren. Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos und könnte die Uneinigkeit weiter verstärken.
5.1.5 Das Tripelmandat
Im Tripelmandat von Staub-Bernasconi geht es darum, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit von verschiedensten Seiten her Aufträge erhalten. Durch die verschiedenen Blickwinkel, Prioritäten und Ansichten können sich die Aufträge widersprechen oder unterscheiden. Somit kommen Sozialarbeitende regelmässig in ein Spannungsfeld hinein, worin sie ein Gleichgewicht finden müssen.
Im Folgenden werden die drei verschiedenen Mandate erläutert und schliesslich ihr Zusammenspiel dargestellt.
Das erste Mandat: Die Gesellschaft
Soziale Arbeit sollte sich bewusst sein, dass sie zwei verschiedene Aufträge seitens der Gesellschaft hat. Einerseits einen Hilfe- und andererseits einen Kontrollauftrag. Bei der ersten Funktion gehören beispielsweise Hilfe bei sozialen Problemen, Beratung und Begleitung dazu, bei der zweiten dann mehr ein „indirekter“ Auftrag. Die sogenannte Kontrolle besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Es geht nicht nur darum, einen Auftrag zwanghaft durchzusetzten und sich einer Notlage anzunehmen, sondern auch darum eine Alternative anzubieten für die Betroffenen. Ansonsten sind die Sozialarbeitenden unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht in der Lage diese durchzusetzten (vgl. Röh 2006: 444f.).
Durch soziale Missstände, werden von Seiten der Gesellschaft Angebote geschaffen, in denen Sozialarbeitende arbeiten und ihre Profession ausüben können.
Das zweite Mandat: Die Klientel
„Professionalität fordert als erstes und unverzichtbar das Eingehen auf die Sichtweisen der Klientel (…).“ (Staub-Bernasconi 2018: 117). Es gilt das „anwaltschaftliche Prinzip“ also die Vertretung der Schwachen, Notleidenden und sozial Deklassierten (vgl. Röh 2006: 445).
Den konkreten und ausschlaggebenden Auftrag erhalten wir somit von den Betroffenen, unsere Klientel. Wir versuchen zu ergründen, was die Lage unserer Klientel ist und wo wir dabei unterstützen können.
Als weiteren Schritt soll geschaut werden, warum [Hervorhebung durch die Verf.] eine Situation dementsprechend besteht und was das weitere Vorgehen sein kann, damit Veränderungen vorgenommen werden können. Grundsätzlich muss die Klientel die Berechtigung haben, dieses Vorgehen untersagen zu können (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 117).
Das dritte Mandat: Die Profession
Laut Staub-Bernasconi (2018: 114) hat das dritte Mandat zwei Komponenten. Einerseits „Wenn man davon ausgeht, dass Disziplin und Profession, Theorie und Praxis auf noch zu bestimmende Weise zusammenhängen, dann muss sich ihr Handeln so weit wie möglich auf theoretisch begründete und wissenschaftlich überprüfte Aussagen bzw. Hypothesen beziehen.“ „Da man aufgrund historischer Fakten davon ausgehen muss, dass Soziale Arbeit wie andere Professionen auch im Namen von wirtschafts-, parteipolitischen oder religiösen Interessen, bis hin zu menschenverachtenden Ideologien, Diktaturen, korrupten Potentaten in den Dienst genommen werden kann, braucht es einen eigenen Ethikkodex.“ (Staub-Bernasconi 2018: 114) Der Ethikkodex wird deshalb notwendig, dass sich die Profession in Krisensituationen, in der sie Konsequenzen erzwingen muss, rechtlich begründen kann und professionsethisch legitimiert ist (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 115).
Somit geht es darum, das Doppelmandat zu erweitern, damit die Profession der Sozialen Arbeit eine eigene Identität entwickeln und eigene Standards benennen kann, an denen sie sich orientiert.
Durch die beispielsweise erweiterte Ausbauung des Bildungswesens im Bereich sozialer Dienstleitungen hat sich der Gegensatz zwischen vollständiger Autonomie und vollständiger Weisungsgebundenheit drastisch verringert (vgl. ebd.: 116). „Aufgrund der bisherigen Ausführungen wird die wissenschaftlich und ethisch begründete relative Autonomie im Zusammenhang mit Entscheidungs- und Handlungsspielräumen zum konstitutiven Merkmal einer Profession.“ (Staub-Bernasconi 2018: 116)
Dieses Mandat erlaubt es Sozialarbeitenden auch, sich selbst zu beauftragen und ein soziales Problem in Zusammenarbeit mit den Betroffenen anzugehen (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 118). Dadurch müssen sie nicht auf einen formellen Auftrag warten, sondern können aufgrund ihrer fachlichen Begründung eigenständig handeln, sobald ein Missstand erkennbar wird.
Das dritte Mandat legitimiert Arbeitgebende dabei, Aufträge neu zu gestalten oder umzuformulieren, da die organisationalen Rahmenbedingungen professionelles Handeln im Einklang mit ethischen Standards ermöglichen müssen. Aufträge, die diskriminierend sind oder ethische Standards verletzen und der Klientel oder ihrer Umgebung schaden könnten, müssen mit dem Anspruch übernommen werden, die Verantwortung dafür an die Vorgesetzten und gegebenenfalls auch an die Politik zurückzugeben (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 118).
Die Schweiz hat dazu einen eigenen Berufskodex für die Soziale Arbeit verfasst. Dieser orientiert sich an verschiedensten internationalen Übereinkommen der UNO, wie zum Bespiel die Erklärung der Menschenrechte (1948) [Hervorhebung durch die Verf.] oder der Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006/2008) [Hervorhebung durch die Verf.].
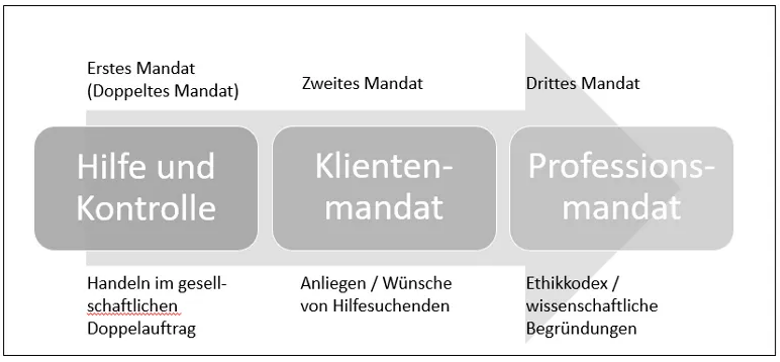
Abb. 1: Tripelmandat nach Staub-Bernasconi (2008)
Interaktions-Dreieck der Mandate
In der Praxis können sich die Professionellen nicht einfach nur an den Texten und Gesetzen orientieren und diese umsetzen. Es handelt sich vielmehr um ein Interaktionsfeld, in dem verschiedene Ansprüche aus den drei Mandaten aufeinandertreffen. Dabei ist eine fallspezifische Aushandlung zwischen den Parteien erforderlich, auch wenn keine einheitliche Haltung der Klientel besteht. Dies muss transparent kommuniziert werden. Treffen die Seiten nicht kompromissbereit aufeinander, so müssen demokratische Verfahren zur Konfliktbearbeitung eingesetzt werden (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 121). „Im UN-Manual „Human Rights and Social Work“ (1994: 5) ist zur dilemmatischen Struktur des Tripelmandates als Leitlinie Folgendes festgehalten: „Die Profession ist beiden verpflichtet, dem Arbeitsgeber wie der Klientel. Aufgrund des Ethikkodexes der Profession sowie der Bildungsziele der Hochschulen für Soziale Arbeit steht der Dienst gegenüber den Menschen höher als die Loyalität zur Organisation.“ (Staub-Bernasconi 2018: 121) „Durch das Machtgefälle zwischen Organisation und Klientel besteht dabei die Gefahr für Sozialarbeiter*innen im schlimmsten Fall ihre Anstellung zu verlieren.“ (Staub-Bernasconi 2018: 121)
„Kritische Soziale Arbeit“ kann im Wesentlichen als Machtkritik definiert werden(…).“ (Staub-Bernasconi 2018: 121) Aufgrund ihres Themas, das soziale Probleme, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit umfasst, ist die Soziale Arbeit im politischen und gesellschaftlichen Kontext kritik- und handlungsfähig. Es dürfte schwer sein, ein soziales Problem zu identifizieren, das keinen gesellschaftlichen und folglich politischen Einfluss hat (vgl. ebd.: 122).
Relationierung
Die beschriebene Situation verdeutlicht das Spannungsfeld, in dem sich die PSA befindet, wenn sie die drei verschiedenen Mandate und ihre unterschiedlichen Aufträge berücksichtigt.
Das Mandat der Gesellschaft legt fest, dass die PSA die KL begleiten muss, um wichtige Informationen zu sichern und die Sicherheit der KL zu gewährleisten. Dies steht im direkten Konflikt mit dem Wunsch der KL, von ihrer Freundin (BW) begleitet zu werden oder alleine zum Termin zu gehen. Die PSA ist somit gezwungen, zwischen den Vorgaben der Organisation und den Bedürfnissen der KL zu vermitteln. Sie muss sicherstellen, dass sie die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen einhält, während sie gleichzeitig ethische Standards wahrt und die Autonomie der KL respektiert.
Die KL äussert klar ihren Wunsch, nicht von der PSA, sondern von ihrer Freundin (BW) oder allein zum Termin begleitet zu werden. Dies zeigt das Mandat der Klientel, welches ihre Autonomie und ihren Wunsch nach Selbstbestimmung betont. Die PSA muss die Bedürfnisse und Präferenzen der KL respektieren, einschliesslich ihrer Privatsphäre und ihrer Vorlieben für die Begleitung zu solchen Terminen.
Die PSA mit ihrem Mandat der Profession, steht unter erheblichem Druck, da sie versucht, diese widersprüchlichen Mandate in Einklang zu bringen. Trotz ihres Verständnisses für die Wünsche der KL bleibt sie gebunden an den Auftrag der Organisation, was zu einem ethischen Dilemma führt. Sie muss einfühlsam argumentieren und Erklärungsversuche unternehmen, um die KL zu überzeugen, jedoch kann dies oft nicht ausreichen, um die Ablehnung der KL zu überwinden.
Die PSA ist letztlich gezwungen, externe Unterstützung durch die PA heranzuziehen, um eine Lösung zu finden, die sowohl den Anforderungen der Organisation gerecht wird als auch die Bedürfnisse der KL angemessen berücksichtigt. Dies zeigt die Komplexität der Sozialen Arbeit, bei der die PSA kontinuierlich zwischen den Erwartungen der Gesellschaft, den individuellen Bedürfnissen der Klientel und den ethischen Standards navigieren muss, um eine faire und professionelle Praxis zu gewährleisten.
5.1.6 Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl
Beim praktischen Nutzen eines solchen Eskalationsmodells stellt sich die Frage nach seinem Mehrwert. Jedoch liegt der Fokus hier mehr auf der Intervention. Für die richtige Auswahl einer Interventionsstrategie ist es entscheidend zu erkennen, wie fortgeschritten ein Konflikt bereits ist (vgl. Glasl 2011: 198).
Für internationale Konflikte wurden bereits verschiedene Ansätze eines „Krisen- oder Friedensbarometers“ unternommen. Das Modell von Glasl ermöglicht nun die Entwicklung eines solchen „Barometers, (…), da es darauf abzielt, Konflikte rechtzeitig und präzise zu erkennen und zu signalisieren, um weiteren negativen Auswirkungen durch konstruktive Massnahmen vorzubeugen.“ (Glasl 2011: 199)
Verschiedene Mechanismen treiben eine Eskalationsdynamik voran. Im Folgenden werden Mechanismen beschrieben, die eine Eskalationsdynamik begünstigen können. Diese gehen oft mit einer Verzerrung der Wahrnehmung einher, die durch das Wechselspiel und das gleichzeitige Auftreten dieser Mechanismen bedingt ist (vgl. Glasl 2011: 207).
- Projektion der Ursache eigener Frustrationen und Probleme auf das Gegenüber. Zusätzlich führen unüberlegte Handlungen zu weiterer Frustration über das eigene Selbst.
- Die Konfliktparteien ziehen immer mehr Aspekte in den Konflikt hinein, was zu einer Zunahme von Umfang und Komplexität führt. Dadurch neigen die Parteien dazu, die Situation stark zu vereinfachen.
- Subjektive und objektive Streitpunkte vermischen sich, was zu Verwirrung über Ursachen und Wirkungen führt und klare Zusammenhänge verschleiert.
- Die Konfliktparteien involvieren zunehmend weitere Unterstützende und tendieren dazu, den Konflikt zu personalisieren.
- Gewaltdrohungen, die als Mittel zur Konfliktbremse gedacht sind und auf eine Nachgiebigkeit der Gegenseite hoffen lassen sollen, beschleunigen oft die Eskalation und führen zu einer noch gewalttätigeren Reaktion der Gegenseite.
(vgl. Glasl 2011: 207f.)
Ein Konflikt beginnt zunächst mit kleinen Spannungen und intensiviert sich stufenweise. Diese Steigerungen der Intensität nehmen die Beteiligten anhand einer kritischen Schwelle wahr, dem sogenannten „Wendepunkt“ (vgl. Glasl 2011: 207).
„Schelling (1957, pp.20 ff.) hat konstatiert, dass auch bei schweigend geführten Verhandlungen eine Abstimmung der Erwartungen und eine „selbstverständliche, stillschweigende Übereinkunft der Vorstellungen“ (tacit agreement) zustande kommen.“ (Glasl 2011: 227) Somit kann sich auch durch nicht verbalisierte Aktionen ein Wendepunkt in einem Konflikt zu einer weiteren Stufe intensivieren (vgl. Glasl 2011: 227). Das Buch „Konfliktmanagement – Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater“ weist auf Th. Schelling hin, der betont, dass diese Schwellenmomente vor allem auf die Gefühle abzielen und weniger auf Logik, dass sie eine symbolische Bedeutung haben und deutlich hervorstechen, indem sie klare Meilensteine setzen (vgl. Glasl 2011: 229).
Jede neue Stufe in einem Konflikt bringt neue Normen und Regeln mit sich, die klar durch Schwellen getrennt sind. Überschreitet eine Partei einen solchen Wendepunkt, öffnet dies die Tür für die nächste Eskalationsstufe. Die Wendepunkte werden oft als „point of no return“ betrachtet, wobei es deutlich schwieriger ist, eine Schwelle zurückzugehen als eine Stufe vorwärts zu schreiten. Diese klaren Schwellen, die intuitiv bei jeder neuen Stufe vorhanden sind, geben den Beteiligten Sicherheit trotz einer Zunahme an Gewalt. Im Allgemeinen scheuen sich die Parteien, eine solche Schwelle zu überschreiten, aus der Sorge heraus, für den „Dammbruch“ verantwortlich gemacht zu werden, weshalb die folgende Eskalationsstufe oft für längere Zeit als unbetretbar respektiert wird (vgl. ebd.: 230f.).
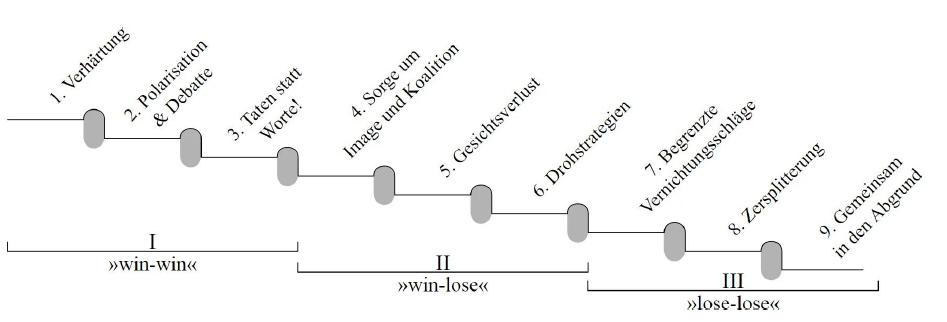
Abb. 2: Stufen und Schwellen der Eskalation (in Anlehnung an: Glasl 2011: 234)
Laut der Theorie von Glasl gibt es neun solcher Eskalationsstufen; im Folgenden wird nur auf die ersten drei eingegangen, da die weiteren für den vorliegenden Fall nicht relevant sind.
Stufe eins: Verhärtung
In dieser Stufe kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten dazu, dass Standpunkte klar definiert und starr vertreten werden. „Die Parteien beharren auf ihren Ideen und Vorschlägen, sind weniger offen und zugänglich für Beeinflussungsversuche der Gegenseite.“ (Glasl 2011: 235) In Momenten erhöhter Spannung neigen sogenannte Adhäsionsgruppen dazu, sich mit diesen Standpunkten zu identifizieren. Bei wiederholten Verhärtungen kristallisieren sich klare Rollen heraus, wie z.B. Personen, die die Initiative ergreifen, und solche, die Verbindungen aufzeigen, die in angespannten Momenten sichtbar werden, sonst aber verblassen. Diese Strategie zeigt für eine gewisse Zeit Wirkung, führt jedoch dazu, dass die Parteien in Erwartungshaltung aufeinander treffen, wenn sich Konflikte wiederholen. Diese Erwartungshaltung schafft eine belastende Abhängigkeit. Die Parteien erleben bereits Spannungen, bevor ein neuer Konflikt entsteht, da sie diesen bereits antizipieren. Gleichzeitig wird der Aufwand, der nötig wäre, um die Beziehungen zu verbessern oder zu reparieren, als zu gross empfunden. Die Bemühung besteht nun darin, ein weiteres Abgleiten zu verhindern. Beide Parteien sind überzeugt, dass durch eine verbale Auseinandersetzung die Meinungsverschiedenheiten gelöst und die Spannungen abgebaut werden könnten. Jedoch führt die erhöhte Reizbarkeit der Parteien dazu, dass weniger klar kommuniziert wird (vgl. Glasl 2011: 234-238).
Stufe zwei: Debatte und Polemik
Da keine Unterfangung, also Massnahmen zur Lösung der vorherigen Spannungen aus der ersten Phase erfolgreich waren, scheuen die Parteien nun auch verbale Konfrontationen nicht. Es gibt gemischte Motivationen bei den Beteiligten. Einerseits besteht der Wunsch nach Kooperation, um gemeinsame Ziele zu erreichen, andererseits dominiert die Konkurrenz, wodurch die Interessen der eigenen Gruppe stärker betont werden. Durch diese wechselhaften Tendenzen können sich die Spannungen und die Reizbarkeit aller Beteiligten erhöhen. Das gesteigerte Eigeninteresse verstärkt ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Partei, was zu Selbstüberheblichkeit führen kann. Es erfolgt eine Fixierung auf die ursprünglichen Standpunkte, wobei der Fokus darauf liegt, wer diese besser vertritt (vgl. Glasl 2011: 239f.). „Die Parteien agieren nun aus dem Bewusstsein heraus, dass Nachgeben in der Sache nachteilige Folgen für ihre soziale Position, für Macht und Ansehen haben kann.“ (Glasl 2011: 240) Dies trägt zur weiteren Spannung im Konflikt bei, da die Parteien die unterschiedlichen Interessen als ein „Entweder-Oder-Dilemma“ empfinden. Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied im sozialen Verhalten der beiden Gruppen, die mit grosser Vorsicht agieren und der Gegenseite gegenüber misstrauisch auftreten, um keine Nachteile zu erleiden. Dieses Verhalten führt zu Irritationen auf der Gegenseite, die versucht, diese Asymmetrie auszugleichen. Zudem wird den Konfrontationen nicht ausgewichen, um den eigenen und der gegnerischen Gruppe zu zeigen, dass man engagiert ist. Die Gruppen kommunizieren mit „Du-Botschaften“, die ein negatives Urteil implizieren und die andere Partei in ihrer Starrheit bestärken (vgl. Glasl 2011: 240-242).
Durch das ungleiche Ansprechen der Parteien entstehen weitere Verhärtungen, was mithilfe des Transaktionsanalysemodells erklärt wird. Jede Person hat drei verschiedene Ich-Zustände: das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Person A kann Person B aus einem dieser Zustände heraus ansprechen, und Person B kann entsprechend reagieren und die Antwort an die angesprochene Position richten, wodurch die Transaktion komplementär wird (siehe Abb. 3). Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Parteien nicht komplementär zueinander agieren (siehe Abb. 4), was zu Kommunikationsschwierigkeiten führen kann (vgl. ebd.: 242-244).
Obwohl zwei Personen oberflächlich betrachtet auf dem gleichen sozialen Niveau kommunizieren können, wie Erwachsene es tun würden, kann es untergründig-psychologisch eine Ungleichheit geben, wenn sie aus verschiedenen Ich-Zuständen heraus handeln. Dies kann die Komplexität eines Konflikts erhöhen, da Diskrepanzen zwischen dem äusseren sozialen Erscheinungsbild und den psychologischen Dynamiken auftreten können (vgl. ebd.: 243).
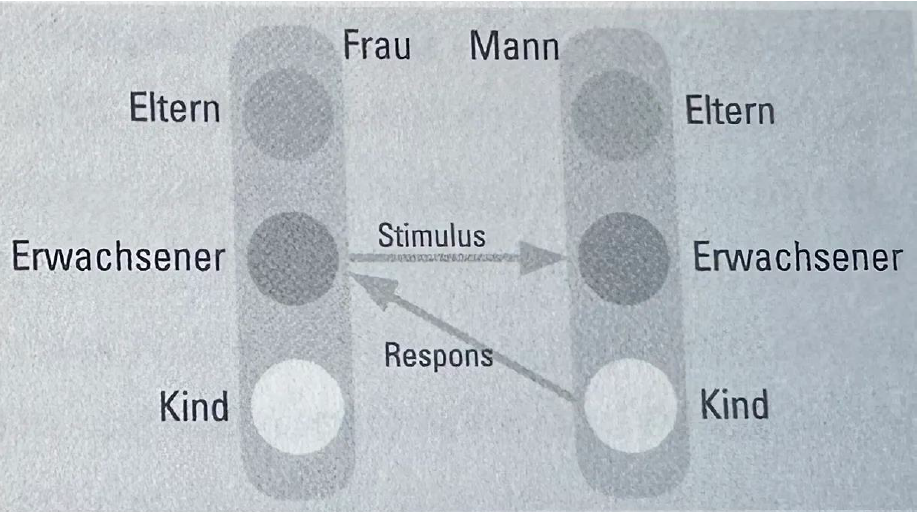
Abb. 3: komplementäre Transaktion (in Glasl 2011: 243)
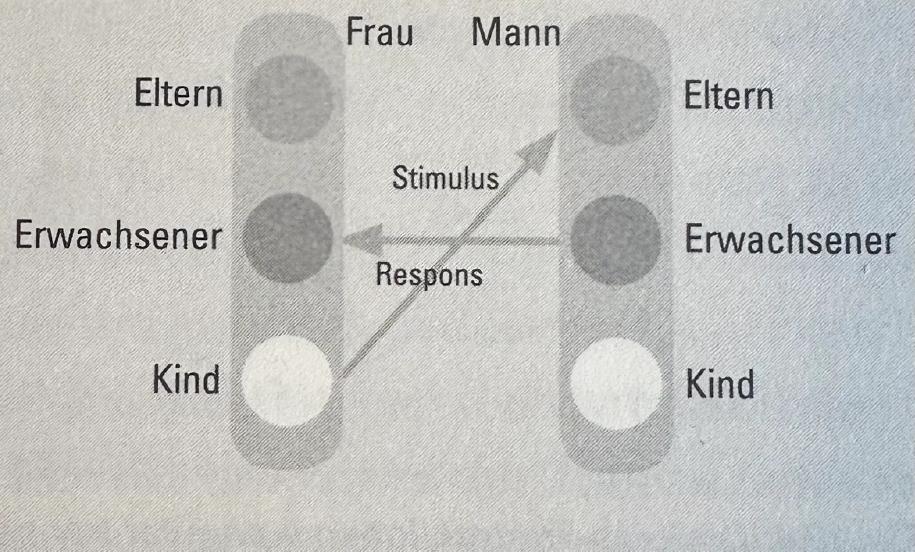
Abb. 4: Gekreuzte Transaktion (in Glasl 2011: 244)
In der Debatte nutzen die Beteiligten rhetorische Mittel, um Druck auf die Gegenseite auszuüben und deren Zustimmung zu erreichen. Dabei bedienen sie sich äusserlich logischer Verfahren, missbrauchen jedoch bewusst oder unbewusst bestimmte Mittel wie extreme Schlussfolgerungen oder suggerierte Zusammenhänge (vgl. ebd.: 244f.).
Stufe drei: Taten statt Worte!
Im Unterschied zu den zwei vorherigen Stufen ist nun eine deutliche Entschlossenheit bemerkbar, die dazu führt, dass die Parteien ohne Zustimmung der Gegenseite versuchen, ihre Anliegen durchzusetzten und die der Gegner:innen zu bremsen (vgl. Glasl 2011: 250). Nach Kahn und Schelling in Glasl ist das Paradoxe daran, dass die Gruppen jeweils nicht dazu bereit sind nachzugeben und ihre Einstellung zu ändern, von der Gegenseite jedoch genau das erwarten (vgl. ebd.: 250). Nach der nicht zielführenden verbalen Auseinandersetzung in der zweiten Stufe, wirken die einseitigen Aktionen mehr wie Fortschritte, wodurch sich die Auseinandersetzung von der intellektuellen auf die der intentionellen Ebene verlagert hat, die verbale Kommunikation gerät somit mehr in den Hintergrund. Nach Festinger in Glasl blockieren sich die Parteien mit ihren Handlungen und Gegenreaktionen gegenseitig, wodurch ein Gruppeninterner Druck zur Einstimmigkeit entsteht, der dazu führt, dass sich die Mitglieder dem Meinungsdruck des Kollektivs anpassen (vgl. ebd.: 250). Der Körpersprache wird mehr Gewicht gegeben als der verbalen Kommunikation, wodurch die Gefahr entsteht, dass bei dieser zunehmenden Interpretation von nonverbaler Kommunikation und dem schwindenden Einfühlungsvermögen in die Gegenseite, eine zunehmende Fehleinschätzung der Absichten der Gegenseite passiert (vgl. ebd.: 252f.). „Es ist paradox: Während es die Intention der Parteien ist, ihre Absichten durch Taten „unmissverständlich“ zu bekunden, schleichen sich unbemerkt viele Fehlerquellen ein, die zu einer negativen Deutung des Geschehens führen.“ (vgl. ebd.: 254)
Relationierung
Es ist schwer zu sagen, ob vorangegangene Situationen bereits in die hier behandelte Situation eingeflossen sind und zu einer Entwicklung bestimmter Spannungen und Erwartungen der beiden Parteien geführt haben.
Auf der Stufe eins, “Verhärtung“, versuchen beide Parteien, über verbale Kommunikation eine Lösung zu finden und die Gegenpartei von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Die beiden Bewohnerinnen bilden ebenfalls ein Team, wobei die KL dominanter auftritt und mehr argumentiert, während die BW eine unterstützende Rolle übernimmt. Es zeigt sich auch ein zunehmendes Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den beiden Jugendlichen.
Aufgrund der anhaltenden Spannung, bei der keine Partei nachgibt, kommt es zum Übergang in die zweite Stufe, „Debatte und Polemik“. Sowohl die PSA als auch die KL arbeiten darauf hin, den Arzttermin wahrzunehmen, wobei sie jeweils auf ihren unterschiedlichen Vorgehensweisen beharren. Die KL äussert mehrmals, dass „Sozis“ über sie bestimmen wollen, und signalisiert damit, dass sie sich nicht als gleichwertig fühlt. Sie spricht eher aus einer Kind-Ich-Position und adressiert die PSA möglicherweise aus einer Erwachsenen-Ich- oder sogar Eltern-Ich-Position. Die PSA hingegen spricht die KL als Erwachsene an und nimmt deren Anliegen ernst sowie als gleichwertig wahr. Diese unterschiedlichen Positionen führen zu weiteren Verhärtungen und Anspannungen.
Auch Merkmale der Stufe drei, „Taten statt Worte“, sind erkennbar. Die KL möchte sich durchsetzen, ohne die Zustimmung der PSA zu erhalten, und ist nicht bereit nachzugeben. Während der Reflection in Action wurde deutlich, wie die Körpersprache eine zentrale Rolle spielte und verstärkt darauf reagiert wurde oder sie vermehrt zum Ausdruck kam.
Es lassen sich mehrere Gründe identifizieren, warum die Standpunkte verhärtet waren und sich die KL und die PSA nicht einigen konnten. Schliesslich wurde der Konflikt aufgelöst, wenn auch nicht nachhaltig gelöst, indem die PSA die PA hinzuzog.
5.2 Interventionswissen – Wie kann ich als professionelle Fachperson handeln?
Wie kann die PSA die Konfliktsituation professionell (effizient und nachhaltig) auflösen?
5.2.1 Neue Autorität nach Heim Omer
Wie beim Erklärungswissen zur Neuen Autorität ausgeführt, ist die Präsenz der PSA ein zentrales Element einer gelingenden Kommunikation und Beziehung zwischen PSA und KL. Die pädagogische Präsenz wird in vier Wirkungsbereiche aufgeteilt, um diesen weiten Begriff genauer zu differenzieren.
Die körperliche Präsenz beinhaltet das Einhalten von Terminen und Vereinbarungen. Die emotionale Präsenz drückt Nähe aus und verweist gleichzeitig auf Grenzen, die handelnde Präsenz ist der Handlungsschritt, der aufgrund der Emotionalen Präsenz ersichtlich wurde und die interpersonelle Präsenz drückt das gemeinsame Regelwerk der Institution und die Teamarbeit in der Wir-Form aus (vgl. Omer/Haller 2020: 39f.).
Im Buch „Raus aus der Ohnmacht“ wird eine Intervention der fokussierten Präsenz nach Frederic Jones vorgestellt. In dieser Intervention wendet sich die PSA physisch ganz der KL zu, schaut diese ruhig an und wartet ruhig ca. 20 Sekunden. Die Körpersprache der PSA signalisiert: „Ich bin hier und bleibe hier!“ Auch signalisiert die Körperhaltung der Zuwendung mit dem ganzen Körper die Ernsthaftigkeit der Intervention. Physische Präsenz durch zugewandte Körpersprache eignet sich, um Kindern aller Altersgruppen Grenzen zu setzen (vgl. ebd.: 42).
Ein neues Verständnis von Autorität, das Selbstkontrolle betont, kann einen Weg aus der Ohnmacht weisen. Dies schliesst die Erkenntnis ein, dass die PSA das Verhalten der KL nicht kontrollieren kann. Was die PSA jedoch kontrollieren kann, ist ihre eigene Haltung und somit den Einfluss, den sie auf die KL mit dieser nimmt. Mit der Haltung der Einflussnahme anstelle der Kontrolle befreit sich die PSA von der „Schuld“ am gelingenden Verhalten der KL und kann mit erhöhter mentaler Präsenz für die KL da sein. Mit der Haltung der Beharrlichkeit anstelle des Gewinnens können Machtkämpfe vermieden werden (vgl. ebd.: 29).
Relationierung
In der zweiten Sequenz der Reflection in Action nimmt die PSA eine gekrümmte Haltung ein, spielt mit ihren Händen und auch an ihrem Hosenbein. Um auf die Interventionsmöglichkeit der physischen Präsenz einzugehen, wäre es wichtig, dass die PSA ihre Körperhaltung bewusst verändert. Die PSA würde ihrer entschlossenen Präsenz Ausdruck verleihen, indem sie eine aufrechte Körperhaltung einnimmt und sich der KL direkt körperlich zuwendet. Auch strahlt das Bewegen der Hände und spielen am Hosenbein durch die PSA Unsicherheit aus, welche die KL wahrnehmen könnte. Eine ruhige Körperhaltung kann durch Selbstkontrolle der PSA eingenommen werden und somit ein natürliches Autoritätsverständnis hergestellt werden.
Die emotionale Präsenz der PSA wird durch das empathische Eingehen und das Aufbringen von Verständnis der Emotionen der KL deutlich ausgedrückt. Gleichzeitig verweist die PSA auf die Wichtigkeit der Begleitung und bringt diese argumentativ hervor. Die Grenze, dass die Begleitung auf jeden Fall stattfindet, auch wenn die KL Widerstände hat, müsste in der emotionalen Präsenz der PSA deutlich zum Ausdruck kommen.
Die handelnde Präsenz der PSA wird in der Situation deutlich, als sie versucht, die KL zu einem Einzelgespräch zu überzeugen. Dabei betont sie argumentativ die Sinnhaftigkeit der Begleitung und holt Unterstützung zur Lösung der Situation ein. In der handelnden Präsenz hätte die PSA bei der Schilderung der Situation gegenüber der PSA mitteilen können, dass sie gegenüber der KL als Team auftreten möchte und dass sie sich daher einen kurzen Austausch und eine gemeinsame Lösungsfindung wünsche. Vor dem Hintergrund, dass der PSA der enge Zeitrahmen bewusst ist und die gemeinsame Lösungsfindung möglichst effizient stattfinden sollte.
Die interpersonelle Präsenz der PSA wird in der Situation deutlich, indem die PSA das Regelwerk der Institution sehr klar argumentativ zum Ausdruck bringt. Die Teamarbeit in der Wir-Form wird sprachlich von der PSA in der Situation angewandt, indem Sie Bezug nimmt zum sozialpädagogischen Team. Beim argumentativen Hervorbringen der Regeln der Institution könnte sprachlich die Wir-Form angewandt werden, damit die KL die Durchsetzung der Regel weniger auf die PSA persönlich bezieht. Aus Sicht der KL und BW sind PSA und PA möglicherweise als Team aufgetreten, aus Sicht der PSA fühlt sie sich mit der PA nicht in Teamarbeit. In der Situation hätte die PSA das Gefühl übergangen zu werden der PA vor der Konfrontation mit der KL oder danach mitteilen können.
In der Situation wird der Versuch zur Aufforderung eines Machtspiels seitens der KL und BW deutlich indem sie eher abwertend von den Sozis spricht und die PSA in ihrer Haltung zur Gegnerin macht. Die PSA sollte sich in diesem Moment ihrer eigenen Haltung bewusst werden und diese in eine Haltung der Beharrlichkeit anstelle des Kampfes wandeln. Somit bietet die PSA keine Gegnerin und Angriffsfläche mehr für die KL und BW und lässt sich nicht auf das „Spiel“ ein. Somit kann das Machtspiel für die KL und BW an Anreiz verlieren.
5.2.2 Gruppendynamik
Deindividuation (Deindividuierung) nach Leon Festinger:
Die selbstfokussierte Aufmerksamkeit kann aggressivem oder impulsivem Verhalten, das durch durch den Prozess der Deindividuierung ausgelöst wird, entgegenwirken. Sie sorgt dafür, dass persönliche Standards und moralische Werte wichtiger werden, sodass man sich wieder stärker an eigenen Normen und moralischen Vorstellungen orientiert (vgl. Werther et al. 2020: 359).
Gruppendenken nach Irving Janis:
Um dem Gruppendenken entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Interventionsmöglichkeiten. Zum einen ist es wichtig, offen für abweichende Meinungen zu sein und diesen Raum und Anerkennung zu geben. Strukturiertes Vorgehen bei der Informationssammlung und -auswertung sowie die Verwendung von Entscheidungshilfen können ebenfalls hilfreich sein, um die Qualität der Entscheidungen zu verbessern. Eine offene Haltung gegenüber verschiedenen Meinungen und die Bereitschaft, Uneinigkeit zuzulassen und zeitweise zu akzeptieren, können ebenfalls zu besseren Entscheidungen führen (vgl. Werther et al. 2020: 212). Im Gegensatz dazu steht die direktive Führung, was ein autoritärer Führungsstil ist, bei dem klare Anweisungen und Entscheidungen von der Führungskraft getroffen werden. Es wurde gezeigt, dass in Gruppen mit nichtdirektiver Führung oft mehr Lösungsvorschläge eingebracht und mehr Informationen berücksichtigt werden, was die Entscheidungsqualität fördern kann (vgl. ebd.: 213).
Relationierung
Eine Möglichkeit, eine Einzelperson aus der Deindividuierung zurückzuholen und ihr Verantwortungsgefühl zu stärken, ist durch den Ansatz der selbstfokussierten Aufmerksamkeit. Dabei wird die Einzelperson an ihre eigenen Werte erinnert, die sich durch die Gruppendynamik verschoben haben.
In der beschriebenen Situation versucht die PSA dies auf verschiedene Weise. Sie erinnert die KL an die getroffene Vereinbarung und an die positive Erfahrung des letzten Mals, als es „sehr lustig“ war. Zudem betont die PSA, dass ihr das Respektieren der Privatsphäre der KL wichtig sei und sie wie beim letzten Mal im Wartezimmer bleiben würde, um die Intimsphäre der KL zu achten.
Die PSA erklärt auch die Wichtigkeit der Begleitung für den Beziehungsaufbau und die Sicherstellung, dass alle Gesundheitsinformationen zum sozialpädagogischen Team gelangen. Dies soll der KL die rationale und wohlwollende Absicht hinter der Begleitung verdeutlichen und die Wahrnehmung der Kontrolle durch die PSA als positiv und hilfreich darstellen.
Durch diese Argumente versucht die PSA, die KL an ihre eigenen positiven Werte und Erfahrungen zu erinnern und die von der PSA empfundenen negativen Einflüsse, die durch die Anwesenheit und Bestärkung der BW entstehen, zu minimieren.
Um die KL aus dem Gruppendenken herauszuholen, was unter anderem die Entscheidungsqualität einer Diskussion hemmt, tangiert die PSA verschiedene Ansätze. So zeigt die PSA Verständnis für die Gefühle der KL, indem sie anerkennt, dass sie die Begleitung als unangenehm und intim empfindet. Diese Offenheit schafft Raum für die KL, ihre Bedenken auszudrücken. Die PSA versucht die Situation bis zu einem bestimmten Grad zu strukturieren, indem sie an die vorherige Absprache, die klar gesetzten Rahmenbedingungen und die positive Erfahrung beim letzten Mal erinnert. Ausserdem spricht die PSA die Uneinigkeit direkt an, indem sie die KL fragt, warum sie ihre Meinung geändert hat, und versucht, die Gründe für den Widerstand zu verstehen.
Herausforderungen:
Die PSA ist in der Situation Herausforderungen begegnet, die ihr das Herausholen der KL aus der Deindividuation wie auch aus dem Gruppendenken erschwert haben.
Die oben aufgeführten Argumente und Bemühungen der PSA blieben erfolglos. Auch auf den Vorschlag, das Gespräch zu zweit fortzusetzen, gingen die Jugendlichen nicht ein, was die mangelnde Kooperationsbereitschaft aufzeigt.
Der Widerstand der KL, der von der BW bestärkt wurde, scheint die PSA verunsichert zu haben, was sich auch in der Reflection in Action zeigt. Dies könnte die Autorität der PSA geschwächt haben, wodurch ihre Überzeugungskraft nicht ausreichte, um die KL zu einem Umdenken zu bewegen. Aus der Reflection in Action lässt sich ausserdem ableiten, dass es der PSA wichtig ist die Autonomie der KL zu respektieren. Dies scheint in dieser Situation zu einem inneren Konflikt der PSA zu führen. Da sie Verständnis für die Situation der KL hat, möchte die PSA nicht autoritär durchgreifen, wie sie es schon oft bei ihren sozialpädagogischen Mitarbeitenden beobachtet hat, und damit eine Form der Machtausübung reproduzieren.
Eine weitere Herausforderung für die PSA war das Misstrauen der KL, die die Begleitung als unangenehme Kontrolle empfand. Dieses Vertrauensproblem scheint die Beziehung zwischen der KL und der PSA erheblich zu belasten.
Neben dem widerstandsstärkenden Einfluss der BW erschwerte auch der Zeitdruck, die ÖV-Verbindung zu erwischen, den Aufbau von Vertrauen zur KL. Es scheint, dass keine weiteren flexiblen oder kreativen Lösungen zur Verfügung standen, um die Situation zu deeskalieren.
Die Vorschläge und der begrenzte Handlungsspielraum kamen von der PSA. Dabei hat sie die KL nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen, was jedoch wichtig wäre, um die Konfliktlösung partizipativ zu gestalten und die KL zu motivieren, eine Abmachung auch einzuhalten. Durch die nicht-direktive Haltung der PSA und das Aufzeigen der Wichtigkeit der Begleitung schuf sie eine Grundlage für Partizipation, also die Beteiligung am Prozess und der Lösungsfindung. Sie hielt sich mit Anweisungen zurück, was eine gute Basis für partizipative Zusammenarbeit bieten könnte. In dieser Situation war dies jedoch nicht förderlich, da die PSA diese Erwartung nicht klar an die KL kommunizierte. Diese Zurückhaltung konnte von der KL eher als mangelnde Autorität wahrgenommen werden. Als die PSA schliesslich keine weiteren Handlungsmöglichkeiten mehr sah, entschied sie sich, die PA um Hilfe zu bitten, was die Autorität der PSA möglicherweise weiter beeinträchtigen könnte.
Der unerwartete Widerstand der Jugendlichen überraschte die PSA, wie aus der Reflection in Action hervorgeht. Hinzu kam der Anspruch der PSA an sich selbst, die Situation alleine bewältigen zu können, ohne externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Gefühl der Überrumpelung könnte zu einem Mangel an Selbstvertrauen geführt haben, was wiederum den Wunsch verstärkte, die Kontrolle zu behalten und keine Hilfe von aussen anzunehmen. Daher zögerte die PSA, den Input eines weiteren professionellen Blickwinkels einzuholen, und fühlte sich dann, als sie schliesslich die PA um Hilfe bat, möglicherweise als Versagerin oder als hätte sie die Kontrolle verloren.
5.2.3 Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl
Glasl führt nach der Erläuterung der Eskalationsstufen verschiedene Arten von Interventionen ein. Im Folgenden werden zwei spezifische Interventionen näher betrachtet.
Es gibt viele verschiedene Ansätze, und nicht alle sind für jeden Konflikt gleichermassen wirksam. Besonders zwischen heissen und kalten Konflikten gibt es oft grosse Unterschiede in der Wirkung der Interventionen. Eine Massnahme kann in einem Fall zu Entspannung und Lösung führen, während sie in anderen Fällen zu weiteren Verhärtungen führen kann (vgl. Glasl 2011: 313).
De-eskalierende Interventionen:
In den oben genannten Eskalationsstufen wurden Merkmale verschiedener Eskalationen beschrieben. Diese Merkmale können auch umgekehrt zur Deeskalation genutzt werden. Wenn solche Anzeichen auftreten, können sie den Parteien bewusst gemacht werden, um sie darauf aufmerksam zu machen. Ebenso kann man die unerwünschten Auswirkungen ihres Handelns mit ihrer beabsichtigten Handlung vergleichen. Dies kann zur Entspannung des Konflikts führen und den Parteien Einsicht geben, dass sie den Konflikt unter Kontrolle bringen könnten. Vor allem bei heissen Konflikten lohnt es sich, de-eskalierende Interventionen anzuwenden (vgl. Glasl 2011: 314f.).
Eskalierende Interventionen:
Bei kalten Konflikten bleiben oft unausgesprochene Spannungen bestehen, und es wird so getan, als gäbe es keinen Konflikt. Es kann daher notwendig oder einfacher sein, den Konflikt weiter zu eskalieren, damit er offensichtlich wird und die Beteiligten zugeben können, dass ein Konflikt vorhanden ist. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass eine dritte Partei eine mögliche Entwicklung prognostiziert und die Parteien fragt, ob sie für diese Folgen verantwortlich gemacht werden möchten (vgl. Glasl 2011: 315).
Relationierung
In diesem Fall handelt es sich um einen heissen Konflikt, in dem die PSA und die KL miteinander sprechen und eine Diskussion entsteht. Die PSA versucht de-eskalierende Interventionen anzuwenden, um die Situation zu lösen. Zunächst zeigt sie Verständnis für die Privatsphäre der KL und betont, dass sie im Wartezimmer bleiben wird, um deren persönlichen Raum zu respektieren. Sie erinnert die KL an positive Erfahrungen aus der Vergangenheit und versucht, sie davon zu überzeugen, dass die Begleitung durch die PSA nicht als Kontrolle ihrer Privatsphäre aufgefasst werden sollte.
Jedoch zeigt die KL von Anfang an Widerstand und argumentiert, dass sie sich unwohl fühlt, von einem „Sozi“ begleitet zu werden. Die Unterstützung einer anderen BW verstärkt diese Ablehnung weiter. Trotz mehrerer Erklärungsversuche seitens der PSA und dem Angebot einer privaten Diskussion zeigen weder die KL noch die unterstützende BW Bereitschaft zur Kooperation oder zur Fortführung der Diskussion in einem anderen Rahmen.
Die PSA erlebt eine Erschöpfung der Argumente und fühlt den Druck der Situation, den Konflikt lösen zu müssen. Angesichts der begrenzten Handlungsoptionen, der festgefahrenen Situation und der Unnachgiebigkeit der KL ruft die PSA schliesslich die PA zu Hilfe. Die PA nimmt eine entschiedene Haltung ein und setzt die Lösung des Konflikts durch, indem sie darauf besteht, dass die PSA und die KL gemeinsam zum Termin gehen sollen, ohne weitere Diskussionen zuzulassen.
In diesem heissen Konflikt wäre eine eskalierende Intervention, wie eine weitere Anheizung der Diskussion, wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen und hätte zu noch mehr Anspannung geführt. Die de-eskalierenden Bemühungen der PSA, obwohl letztlich nicht erfolgreich, waren daher die angemessenere Strategie, um eine weitere Verschärfung des Konflikts zu vermeiden.
5.2.4 Professionelle Deeskalation nach Lars Mechler
Grundprinzipien im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern und Jugendlichen (KuJ):
Sicherheit gewährleisten: Jedes Teammitglied sollte regelmässig reflektieren, welche Bedürfnisse es hat, um sich sicher zu fühlen, einschliesslich physischer, psychischer, sozialer und struktureller Aspekte.
Klarheit schaffen: Unklarheit und Desorientierung können aggressive Eskalationen fördern. Gut informierte und orientierte sozialpädagogische Fachkräfte können durch klare Kommunikation über Regeln, Grenzen und Möglichkeiten Konflikte und Eskalationen reduzieren. Regelmässige Reflexion und Supervision fördern Innere Klarheit.
Ruhe bewahren: Empathie spielt eine wichtige Rolle, um aufgeregte oder verängstigte Kinder und Jugendliche zu beruhigen. Sozialpädagogische Fachkräfte müssen in der Lage sein, ihre eigene Anspannung und Ruhe wahrzunehmen und zu regulieren, um angemessen zu reagieren.
Vernetzt arbeiten: Es ist wichtig anzuerkennen, dass Expert:innen Unterstützung von anderen Exptert:innen benötigen, um handlungsfähig zu bleiben. Durch die Bereitschaft, Hilfe von Expert:innen anzunehmen und sich zu vernetzen, können schneller und effektiver Unterstützung und Lösungen gefunden werden.
(vgl. Mechler 2022: 21f.)
Definitionen
Herausforderndes Verhalten:
Herausforderndes Verhalten bezeichnet Verhaltensweisen, die deutlich von den gewünschten oder akzeptierten Normen abweichen und Probleme oder Belastungen bei anderen Menschen verursachen können. Es besteht im Allgemeinen keine Schädigungsabsicht, und es kann unbewusst und ohne klare Absicht erfolgen (vgl. Mechler 2020: 23).
Aggression vs. Aggressivität:
Der Autor verwendet die beiden Begriffe gemäss ihrer Ableitung aus verschiedenen Quellen wie folgt:
Aggression wird in der Psychologie als jedes körperliche oder verbale Verhalten definiert, das mit der Absicht ausgeführt wird, jemanden zu verletzen oder zu schädigen. Es ist ein durch Affekte ausgelöstes Verhalten, das auf einen Machtzuwachs des Angreifers oder eine Machtverminderung des Angegriffenen abzielt. Aggression umfasst ein Gefühl, eine Energie oder einen Impuls, der auf verschiedene Weisen ausgedrückt werden kann, wobei aggressives Verhalten, wie Gewalt, eine mögliche Ausdrucksform ist (vgl. Mechler 2022: 24f).
Aggressivität beschreibt die individuelle Tendenz und Intensität aggressiven Verhaltens. Sie umfasst auch unbewusste und nicht immer offen sichtbare aggressive Einstellungen eines Menschen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Begriffe wie Aggression und Aggressivität im alltäglichen Sprachgebrauch oft negativ empfunden und mit Schuld assoziiert werden. Daher soll im Vorfeld geklärt werden, wenn der Begriff „aggressives Verhalten“ als sachliche Beschreibung des Verhaltens verwendet wird. Dies hilft, Missverständnisse und ungewollte Gefühle von Beschuldigung und Abwertung zu vermeiden (vgl. ebd.: 25).
Reaktives bzw. affektives Aggressionsverhalten:
Reaktives oder affektives Aggressionsverhalten wird durch unmittelbare externe Reize ausgelöst. Wenn ein Mensch beispielsweise akute Angst oder Bedrohung erlebt, kann er aggressiv reagieren, um sich zu verteidigen. In solchen Situationen dient die Aggression primär dem Zweck, unerwünschte und unangenehme Reize wie einen Angriff von sich oder anderen abzuwehren. Die Hauptmotivation liegt dabei im Selbstschutz, nicht in der Absicht, einem anderen Menschen Schaden zuzufügen (vgl. ebd.: 28).
Modell der Erregungskurve
Um eine Deeskalationssituation erfolgreich zu bewältigen, ist es entscheidend, die Situation zunächst richtig einzuschätzen. Die Herangehensweise und Interventionsstrategien der sozialpädagogischen Fachkräfte sollten dabei vom aktuellen Anspannungs- und Erregungszustand der betroffenen Personen abhängen. Die verschiedenen Aggressionsformen lassen sich anhand der emotionalen Erregung der Beteiligten grob in zwei Bereiche einteilen: den „grünen“ Bereich der proaktiven oder instrumentellen Aggression, in dem die Emotionalität und Anspannung üblicherweise geringer sind, und den „orangenen und roten“ Bereich der reaktiven Aggression, in dem die emotionale Anspannung höher ist, die im Kontrollverlust gipfelt. Zwischen den einzelnen Phasen gibt es fliessende Übergänge.
Im Fall instrumenteller Aggression wird diese eher bewusst und gezielt als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen eingesetzt. Die Handlungen sind meist bewusst ausgeführt, obwohl die Beteiligten sich den daraus resultierenden Konsequenzen möglicherweise nicht bewusst sind.
Im orangenen und roten Bereich tritt weniger bewusstes und planmässiges Verhalten auf. Die Betroffenen stehen unter auffälligen bis massiver Erregung, die oft als Reaktion auf auslösende Reize entsteht. Je intensiver die emotionale Anspannung, desto stärker wird das Verhalten von emotionalen und intuitiven Impulsen gesteuert (vgl. Mechler 2022: 29).
Mechler empfiehlt sozialpädagogischen Fachkräften je nach Anspannungsstufe der KL in den Bereichen „grün“, „orange“ und „rot“ wie folgt zu reagieren:
- Anspannungsstufe 1-4 (grün): Es erfolgt ein sachliches und klares Begrenzen, sowie das Entziehen von Erfolgserlebnissen. Zusätzlich wird versucht, Motivation zu schaffen und Lernkontexte für erwünschtes oder alternatives Verhalten zu schaffen.
- Anspannungsstufe 5-7 (orange): Hier liegt der Fokus auf der emotionalen Beruhigung und dem Verringern der emotionalen Erregung.
- Anspannungsstufe 8-10 (rot): Es wird versucht, eine emotionale Beruhigung zu erreichen, wobei besonderes Augenmerk auf die Sicherung und den Schutz vor Verletzungen und Schäden gelegt wird.
(vgl. ebd.: 30)
Ursachen und Gründe für akutes („problematisches“) Verhalten
Das Eisbergmodell veranschaulicht die Ursachen und Gründe für „problematisches“ Verhalten. Dabei stellt das sichtbare Verhalten lediglich die Spitze des Eisbergs dar, während darunter liegende Emotionen, Bedürfnisse, Kompetenzen, Umweltfaktoren, Wahrnehmung sowie soziale, kulturelle, biographische und genetische, medizinische Faktoren die eigentlichen Gründe für das Verhalten ausmachen. Die Faktoren „individuelle Kompetenz“ und „Wahrnehmung“ lassen sich nur bedingt und mittelfristig direkt beeinflussen und durch pädagogische Arbeit gestalten, während die tieferliegenden Faktoren meist nur sehr eingeschränkt bis gar nicht direkt beeinflusst werden können. Häufige Gründe für herausforderndes Verhalten sind unter anderem das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Macht oder die Unterbrechung von Langeweile.
Konflikte, so betont Mechler, entstehen nicht durch die Bedürfnisse selbst, sondern durch sozial-inkompatible Strategien zu deren Erfüllung (vgl. ebd.: 31f.).
Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass sich ein Mensch nur dann verteidigt, wenn er sich bedroht oder angegriffen fühlt. Eine soziale Interaktion ist immer ein zirkulärer Prozess, indem die Wahrnehmung von Umweltreizen und deren Interpretation das Verhalten beeinflussen. Besondere Herausforderungen ergeben sich bei der Arbeit mit traumatisierten Personen, die tendenziell Bedrohungen in neutralen Reizen sehen.
Mechler bezieht sich in seinem Buch auf die vier verschiedenen Verhaltensoptionen, aus denen eine Person wählen kann, wenn sie sich subjektiv in einer Bedrohungssituation befindet: das Anspringen des Bindungssystems, bei dem Unterstützung und Schutz bei einer vertrauten Bezugsperson gesucht werden, Flucht, Kampf und Erstarren/Unterwerfung. Es kommt häufig vor, dass das sozialpädagogische Personal das Verhalten der betroffenen Personen anders bewertet, ohne die subjektive Bedrohungssituation zu erkennen. Um den daraus resultierenden Kreislauf von Verhalten und Reaktion zu unterbrechen, müssen Sozialpädagog:innen über entsprechendes Wissen und soziale Fähigkeiten verfügen, um sozialen Dynamiken professionell zu begegnen (vgl. ebd.: 32-35).
Soziale Wahrnehmung als Grundlage sozialen Verhaltens
Der Autor unterstreicht die Rolle der Sozialpädagog:innen als Bestandteil des Interaktionssystems bei der Arbeit mit „aggressiven“ Kindern und Jugendlichen. Ihr eigenes Verhalten und ihre Rolle haben einen massgeblichen Einfluss auf das Gesamtsystem, weshalb eine kontinuierliche Reflexion eigener Muster, Einstellungen und Werte sowie die Bewertung der Auswirkungen des eigenen Handelns unerlässlich ist. Dies gewährleistet ein kohärentes und nachvollziehbares Verhalten.
Die Wahrnehmung von Verhalten ist subjektiv und stark von individuellen Erwartungen, Mustern und dem Kontext beeinflusst. Die Wirklichkeitskonstruktion der Sozialpädagog:innen gegenüber den Kindern und Jugendlichen sowie dem Kontext prägt ihre Handlungen und Sichtweisen massgeblich. Es ist entscheidend, die wahrgenommenen und konstruierten Erwartungsmuster kontinuierlich zu reflektieren. Dies beinhaltet, die positiven Persönlichkeitsmerkmale wie Stärken und Potenziale der Kinder und Jugendlichen anzuerkennen und zu fördern, anstatt sich ausschliesslich auf Defizite zu konzentrieren, um Eskalationen zu vermeiden.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass aggressives Verhalten bei Kindern im Vorschulalter und bei Menschen mit Entwicklungseinschränkungen oft auf Entwicklungsbedingungen zurückzuführen ist. Daher sollten pädagogische Modelle und Haltungen entsprechend angepasst werden.
Es wird empfohlen, dass Sozialpädagog:innen klar und besonnen auf Provokationen reagieren, um ein gutes Vorbild zu sein und die Legitimität ihrer Forderung nach entsprechendem Verhalten bei den Kindern und Jugendlichen zu stärken. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Selbstreflexion unter Verwendung des Modells der „Erregungskurve“ (oben ausgeführt) für die professionelle Praxis betont. Diese Selbstreflexion ermöglicht es Sozialpädagog:innen, ihre Verhaltensmuster in angespannten Situationen zu erkennen und gegebenenfalls anzupassen, um eine effektive Interaktion zu gewährleisten. Es wird auch auf die Übertragung von Emotionen und die Wichtigkeit der professionellen Distanz zur Situation hingewiesen, um die Qualität der sozialpädagogischen Arbeit zu erhalten. Dabei ist die Person von ihrem Verhalten zu trennen. Je grösser die emotionale Übertragung in Hochspannungseskalationen ist, desto schwerer fällt es den Fachkräften, diese Trennung einzuhalten (vgl. ebd.: 41-44).
Deeskalative Konfrontation
Mechler bezieht sich auf das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun und entwickelte daraus eine Methode für kontrolliert-deeskalative Konfrontation und Grenzsetzung:
- Kontakt aufbauen: Den Namen der eskalierenden Person nennen, begleitet von angemessener Mimik und Tonlage.
- Sachbotschaft formulieren: Die Grenzverletzung klar und ohne Wertung oder Interpretation benennen.
PAUSE - Persönliche Wertung ausdrücken: Die persönliche Bedeutung oder Bewertung der Grenzverletzung in einer Ich-Botschaft mitteilen.
PAUSE - Appell äussern: Das gewünschte Verhalten klar in einer Ich-Botschaft formulieren.
PAUSE
Mit der letzten Pause wird Raum gelassen, damit das Gegenüber das Gesagte einordnen kann.
Eine wertende Botschaft (z.B. „Ich finde es nicht in Ordnung…“ oder „Es kotzt mich total an…“), wie sie in der Alltagskommunikation häufig verwendet wird, ist als Einstieg nicht unbedingt geeignet, da sie sehr emotionsgeladen ist und zu einer ungünstigen Eskalation führen kann.
Das Modell der „Kontrolliert eskalierenden Konfrontation/Grenzsetzung“ präsentiert verschiedene Eskalationsstufen, die verwendet werden können, um Kinder und Jugendliche mit unerwünschtem oder unerlaubtem Verhalten zu konfrontieren. Diese Stufen sind wie Treppenstufen von unten nach oben hierarchisch angeordnet, beginnend mit der „Kontaktaufnahme + gelassenen und indirekten Konfrontation“, gefolgt von der „Entspannten Konfrontation“, dann der „Freundlichen Aufforderung“, der „Direktiven Anweisung“, der „Ankündigung“ und schliesslich der obersten Stufe, der „Konsequenz“. Die Wirksamkeit dieser Intervention hängt davon ab, wie angemessen die gewählte Eskalationsstufe für die spezifische Situation ist und wie gut die verbale und non-verbale Kommunikation zwischen den Beteiligten harmoniert. Eine gelungene Abstimmung in diesen Bereichen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Botschaft so verstanden wird, wie sie von den Sender:innen gemeint ist. Dabei ist wichtig zu beachten, dass der Reiz, der von der Konfrontation oder Intervention ausgeht, seitens der sozialpädagogischen Fachkraft nicht intensiver sein sollte als die Störung, gegen die er gerichtet ist. Ausserdem hängt die Überzeugungskraft einer Autorität bei einem Regelverstoss vor allem von einem überzeugend souveränen Auftreten ab und weniger von überzeugenden Argumenten.
Kommunikativer Status
Unterschiedliche Wahrnehmungen einer Botschaft oder Aussage können zu Missverständnissen und Konflikteskalationen führen. Besonders schnell kann dies passieren, wenn Personen versuchen, sich gegenseitig in ihrem Status zu übertreffen. Status bezieht sich dabei darauf, wie eine Person sich selbst und von anderen wahrgenommen wird, basierend auf Faktoren wie Autorität, sozialem Ansehen oder Wissen. Diese Dynamik ähnelt einer „Statuswippe“: Wenn eine Person sich in einem inneren Tiefstatus fühlt – das bedeutet, sie empfindet sich selbst oder ihre Position als niedriger oder unterlegen -, versucht sie oft, diesen Tiefstatus auszugleichen, indem sie auf die andere Person reagiert oder ihren eigenen Status betont.
Die Dynamik kann nur gestoppt werden, wenn mindestens eine Partei in der Lage ist, in einem Moment des gefühlten Tiefstatus zu verharren. Dies erfordert einen inneren Hochstatus, also die Fähigkeit, trotz äußerer Herausforderungen ruhig und souverän zu bleiben. Diese Stabilität hilft, Eskalationen zu vermeiden und die Kommunikation auf eine konstruktive Ebene zurückzuführen (vgl. Mechler 2022: 92f.).
Spannungsreduktion
Spannungsreduktion bezeichnet Massnahmen zur Verminderung emotionaler Anspannung bei hochangespannten Personen. Dies umfasst Ablenkung, Bedürfnisbefriedigung, akute Versorgung, Zuhören, Verstehen, Hilfeleistung, körperliche Beruhigung, sichernde Präsenz und kontrolliertes Ausagieren. Bewegung ist besonders effektiv, um Stresshormone abzubauen und die Hirnfunktion zu harmonisieren.
Techniken des Spiegelns zur Spannungsreduktion:
- Verbalisieren: Emotionen und Gedanken der Gesprächspartnerin werden in eigenen Worten ausgedrückt, ohne sie dabei falsch zu interpretieren.
- Paraphrasieren: Die Gesprächspartnerin wird in eigenen Worten zusammengefasst, um sicherzustellen, dass sie richtig verstanden wurde.
- Wertfreie Verhaltenswiderspiegelung: Beobachtetes Verhalten wird beschrieben, ohne es zu bewerten oder zu interpretieren.
- Non-verbale Spiegelung: Mimik und Gestik der Gesprächspartnerin werden spiegelbildlich nachgeahmt, um Verbindung und Verständnis zu fördern, wobei darauf geachtet wird, dass dies nicht als Nachäffung empfunden wird.
Diese Techniken helfen dabei, die emotionale Anspannung zu reduzieren, die Kommunikation zu verbessern und eine Grundlage für eine erfolgreiche Deeskalation zu schaffen (vgl. ebd.: 126-131).
Relationierung
Sicherheit gewährleisten: Die PSA respektiert die Privatsphäre der KL und gewährleistet ihre Sicherheit, indem sie ihr Angebot akzeptiert, im Wartezimmer zu bleiben. So stellt sie sicher, dass die KL sicher zum Ziel gelangt und keine medizinischen Informationen verloren gehen. Zusätzlich ist es der PSA wichtig, zu gewährleisten, dass die KL nicht nur zum Termin gelangt, sondern auch sicher zurück zur Institution zurückkehrt.
Klarheit schaffen: Die PSA erklärt klar die Gründe für ihre Begleitung und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit dem sozialpädagogischen Team, um die Gesundheitsversorgung der KL zu optimieren. Sie bietet auch an, die Diskussion in einem ruhigeren Rahmen fortzusetzen, um Missverständnisse zu klären.
Ruhe bewahren: Trotz der Ablehnung durch die KL bleibt die PSA ruhig und verständnisvoll. Sie eskaliert die Situation nicht weiter und holt stattdessen unterstützende Hilfe der PA hinzu, um die Kommunikation zu verbessern.
Vernetzt arbeiten: Die PSA strebt danach, die KL in das Netzwerk einzubinden, indem sie hervorhebt, dass die Begleitung nicht nur der Sicherheit dient, sondern auch dazu, Informationen im Team zu teilen und die Unterstützung für die KL zu koordinieren. Dies unterstreicht die vernetzte Arbeitsweise des sozialpädagogischen Teams. Zusätzlich holt die PSA die PA zur Hilfe und informiert sie über den aktuellen Konflikt, um eine unterstützende Lösung anzustreben.
Deeskalative Konfrontation nach dem 4-Ohren-Modell: Die PSA hat versucht, eine konstruktive Konfrontation zu gestalten. Das Vorgehen der PSA zeigt, dass sie durch den Aufbau eines Kontakts zur KL eine Verbindung herstellen wollte. Obwohl die PSA den Namen der KL nicht aktiv genannt hat, führte die PSA das Gespräch sachlich, indem sie erklärt, warum ihre Begleitung notwendig ist und darauf hinweist, dass dies zuvor besprochen wurde. Sie betont klar und ohne persönliche Wertung, dass sie im Wartezimmer bleiben wird, um die Privatsphäre der KL zu wahren und sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen das sozialpädagogische Team erreichen.
Die PSA verwendet Ich-Botschaften wie „Ich kann dich gut verstehen“ und „Es ist mir wichtig, deine Privatsphäre zu respektieren“, um Verständnis zu zeigen. Sie spricht einen Appell aus, indem sie den Wunsch äussert, die KL zu begleiten, um sicherzustellen, dass keine Informationen verloren gehen und dass die KL sicher ankommt. Die PSA formulierte implizit einen Appell an die KL, indem sie ihre Perspektive darlegt und versucht, sie zu überzeugen, dass ihre Begleitung sinnvoll und im Interesse der KL liegt. Dabei appelliert die PSA an die Vernunft und das Wohl der KL, indem sie die Gründe für die Begleitung erläutert. Schlussendlich formuliert die PA einen klaren Appell, indem sie feststellt, dass es nichts zu diskutieren gibt und die PSA und die KL nun einfach losgehen sollten.
Spannungsreduktion: Die PSA hat Techniken wie Verbalisieren und Verständnis zeigen angewendet, um die emotionale Spannung zu reduzieren und eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Die PSA sucht aktiv nach Lösungen, um die Situation zu klären und die Begleitung so angenehm wie möglich zu gestalten.
Spannungsreduktionstechniken: Es scheint, dass möglicherweise nicht ausreichend Techniken zur Spannungsreduktion eingesetzt wurden, wie Ablenkung, Zuhören oder körperliche Beruhigung, um die emotionale Anspannung bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen zu mindern. Die PSA könnte sich stattdessen auf andere Methoden konzentriert haben, wie aktives Zuhören, die für diese spezifische Situation als angemessener empfunden wurden, um die emotionale Anspannung bei der KL zu reduzieren und eine Grundlage für eine erfolgreiche Interaktion zu schaffen.
Verortung bei der Erregungskurve: Es scheint, dass die PSA sich bewusst war, dass die Situation möglicherweise in einem Bereich tiefer bis mittlerer Anspannung (Stufen 1 bis 6 der Erregungskurve) lag. Die Beschreibung deutet darauf hin, dass die PSA sachlich Grenzen setzte und darauf bedacht war, Erfolgserlebnisse zu vermeiden, indem sie die KL von der BW in der Diskussion trennen wollte. Zudem lieferte sie eine rationale Erklärung für ihre Begleitung. Die PSA hat die Anspannungsstufe der KL offenbar angemessen eingeschätzt und darauf reagiert, da die Situation nicht weiter eskalierte. Dass es lediglich zu Meinungsverschiedenheiten kam und keine Missverständnisse entstanden, deutet darauf hin, dass die PSA die Situation angemessen eingeordnet hat.
Aufmerksamkeit und Macht: Die PSA scheint sich bewusst gewesen zu sein, dass die KL sich bedroht fühlte und möglicherweise nach Unterstützung und Schutz suchte. Indem die PSA einfühlsam und verständnisvoll reagierte, könnte sie dazu beigetragen haben, die Bedürfnisse der KL nach Aufmerksamkeit oder Macht anzuerkennen und in die Interaktion einzubeziehen. Die PSA musste ihre Reaktionen sorgfältig abwägen, um eine unterstützende Umgebung für die KL zu schaffen und gleichzeitig die professionelle Distanz zu wahren. Es scheint, dass die PSA in dieser Dynamik der Interaktion sensibel agierte.
Person von Verhalten trennen: Die PSA hat sich bemüht, sachlich und besonnen auf Provokationen zu reagieren, ohne ihre eigenen emotionalen Reaktionen auf das Verhalten der KL zu übertragen. Dies war entscheidend, um eine professionelle Distanz zu wahren und die Qualität der sozialpädagogischen Arbeit aufrechtzuerhalten. Durch die objektive Betrachtung der starken Verbindung des Verhaltens der KL mit ihren gegenwärtigen Lebensbedürfnissen konnte die PSA dazu beitragen, die Situation erfolgreich zu bewältigen.
Wirklichkeitskonstruktion der PSA: Die PSA könnte die Situation so wahrgenommen haben, dass die KL ein starkes Bedürfnis nach Autonomie und Privatsphäre äußerte. Dies könnte darauf hindeuten, dass die KL bestimmte Erwartungen und Vorstellungen darüber hatte, wie ihre persönlichen Angelegenheiten behandelt werden sollten. Die PSA könnte dies als Zeichen dafür interpretiert haben, dass die KL eine individuelle und respektvolle Begleitung bevorzugte, möglicherweise in Form einer Begleitung durch eine Freundin oder allein.
In ihrer Wirklichkeitskonstruktion könnte die PSA auch die Reaktionen der KL darauf analysiert haben, wie sie auf die Anwesenheit der PSA reagierte. Möglicherweise sah die PSA die Ablehnung ihrer Begleitung nicht als direkte Ablehnung ihrer Person, sondern als Ausdruck der Bedürfnisse und Präferenzen der KL in Bezug auf ihre Privatsphäre und Autonomie.
Um eine Verbindung herzustellen, die die Bedürfnisse der KL respektiert und gleichzeitig professionelle Standards wahrt, könnte die PSA versucht haben, ihre Perspektive und die Notwendigkeit der Begleitung sachlich und verständlich darzulegen. Sie könnte argumentiert haben, dass die Begleitung nicht nur der Sicherheit und dem Informationsaustausch dient, sondern auch dazu beiträgt, eine kontinuierliche Unterstützung und Betreuung sicherzustellen. Dies könnte Teil ihrer Wirklichkeitskonstruktion sein, um die Bedeutung ihrer Rolle und Handlungsweise zu unterstreichen.
Durch die angewandten Massnahmen und die bewusste Berücksichtigung verschiedener Aspekte hätte es der PSA theoretisch gelingen können, die Konfliktsituation professionell, nachhaltig und effizient aufzulösen. Jedoch standen entscheidenden Faktoren entgegen, wie die mangelnde Kooperation der KL, die Verstärkung durch die BW, mögliche Kommunikationsbarrieren sowie Zeit- oder Ressourcenbeschränkungen.
5.3 Erfahrungswissen – Woran erinnere ich mich, was kenne ich aus ähnlichen Situationen?
Welche Erfahrungen hat die PSA (und andere Fachkräfte) in vergleichbaren Situationen gemacht, in denen sie sich im Spannungsfeld zwischen der Förderung der Selbstbestimmung und der Fremdbestimmung zum Wohl der KL befindet?
- Die PSA hat zuvor in der Institution erlebt, dass die Besuche beim Kind einer KL von einer sozialpädagogischen Fachkraft begleitet werden mussten. So sollte sichergestellt werden, dass die KL tatsächlich Zeit mit ihrem Kind verbringt und eine Beziehung aufbauen kann. Vor dieser Vereinbarung kam es mehrmals vor, dass sich die KL zwar im selben Haus wie ihr Kind aufhielt, jedoch anderen Tätigkeiten nachging oder an ihrem Smartphone war. Zu Beginn sträubte sich die KL begleitet zu werden, da sie es als kontrollierend und bewachend empfand. Nach Gesprächen zu urteilen, schien das Gefühl, beobachtet zu werden, in ihr Scham auszulösen, da sie das Gefühl hatte, den Erwartungen in ihrer Rolle als Mutter nicht gerecht werden zu können. Mit der Zeit konnte sie sich jedoch auf den begleiteten Besuch einlassen und freute sich darauf. Die KL erhielt Bestätigung und Zuspruch von der sozialpädagogischen Begleitung und konnte auch zu ihr die Beziehung stärken. Durch das Üben des wiederholten begleiteten Besuchs konnte die KL eine Routine entwickeln und Selbstvertrauen in der Beziehung zu ihrem Kind erlangen. Da die KL nun auch selbstständig in der Lage zu sein scheint intrinsisch motiviert ihr Kind sehen zu wollen und auch beim Kind zu bleiben, kann die Fremdbestimmung abnehmen, was die KL zu mehr Selbstbestimmung befähigt. Diese Situation verdeutlicht, dass es Zeit und Geduld braucht, bis die KL erkennen kann, dass das, was sie zuerst als grenzüberschreitende Fremdbestimmung wahrgenommen hat, sich positiv entwickeln und ihr Freude bereiten kann. Auch hier hat die PSA ein Spannungsfeld wahrgenommen, da das geäusserte Bedürfnis der KL bewusst übergangen wurde. Jedoch nur bis zum Zeitpunkt als die KL wiederholt ihre Selbstständigkeit bewies.
- In einer Institution für Menschen mit kognitiver Behinderung hat die PSA dieses Spannungsfeld vielfach erlebt. Beispielsweise in einer Situation, in der eine Klientin aufgrund einer Weisung der Institutionsverantwortlichen für drei Wochen sozial isoliert wurde. Die Klientin wurde von allen Gruppenaktivitäten ausgeschlossen und durfte nicht an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Die Sozialpädagog:innen wurden zudem angewiesen, sich nicht mehr als fünf Minuten mit der Klientin zu unterhalten und den Kontakt auf die Medikamenten- und Essensabgabe strikt zu begrenzen. Diese Isolierung wurde angeordnet, um negatives Sozialverhalten der Klientin zu sanktionieren, welches verbaler und körperlicher Angriff gegenüber Mitarbeitenden der Institution sowie Sachbeschädigung von Autos von Mitarbeitenden beinhaltete. Für die Sozialpädagog:innen dieser Institution gab es keine Möglichkeit der Mitsprache dieser Entscheidung. Weisungen und Aufträge der Leitung mussten durchgeführt werden. Aus der Perspektive der PSA war diese soziale Isolierung der Klientin ein klarer Verstoss gegen die Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Freiheit und das Recht auf Privatsphäre, welches die Achtung und das Recht auf zwischenmenschliche Beziehungen beinhaltet. Für die PSA war das Spannungsfeld enorm und sie weigerte sich, die Weisung auszuführen, und ergriff das dritte anwaltschaftliche Mandat. Die PSA suchte das Gespräch mit ihrem Vorgesetzen und versuchte Allianzen mit Mitarbeitenden zu bilden, um die soziale Isolation nicht weiterhin aufrecht zu erhalten. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, machten sie einen Eintrag ins Tagesjournal mit einem Auszug aus den Menschenrechten, in welchem sie auf den Verstoss gegen die Menschenrechte hinwiesen, sodass alle Teammitglieder, sowie die Vorgesetzen dies sehen konnten. Daraufhin wurde von den Vorgesetzten eine Sitzung einberufen, in der alle Mitarbeitenden zu Wort kommen durften, und ihre Haltung mitteilen durften. Leider wurde auch daraufhin nichts am Umgang mit der Klientin geändert, und die PSA hat diese Institution mit einem starken Ohnmachtsgefühl verlassen.
- In einem Jugendwohnheim wurden sehr strenge Putzregeln für die Klient:innen festgelegt, die die PSA oft gegen den Willen der Klient:innen durchsetzen musste. Die PSA konnte die Bedeutung des hohen Strukturanspruchs in einem Jugendheim nachvollziehen und die dahinterliegende Haltung verstehen, dass klare Anweisungen und detaillierte Arbeitsabläufe den meist traumatisierten Jugendlichen Stabilität und einen klaren Rahmen bieten können. Als jedoch der Moment des Widerstands gegenüber dem korrekten Ausführen des Putzplans von einer Klientin kam, spürte die PSA ihre eigene Irritation über die starren Regeln und verlor Präsenz und Überzeugung, um voll und ganz hinter dem Auftrag der Institution zu stehen. Dies geschah zum einen, weil sie persönlich einen weniger hohen Anspruch an Sauberkeit hat, und zum anderen, weil der Widerstand gegen das genaue Putzen sie an ihre eigene Jugend erinnerte, in der sie grossen Widerstand gegen Aufräumen und Putzen verspürte. Daher begrenzte ihr Verständnis ihren Handlungsspielraum, und sie konnte die Regeln nur mit Mühe durchsetzen.
- In einem Wohnheim für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen kommt es oft zu Situationen, in denen die PSA Regeln bei Klient:innen durchsetzen muss, die diesen nicht passen und die sie nicht verstehen. Gerade bei Klient:innen mit Autismus ist die Aufrechterhaltung von Regeln und Struktur oft wichtig, da sie ihnen mehr Sicherheit gibt. Es kam dort zu einer Situation, in der eine non-verbale, autistische Klientin einen Tick entwickelte, bei dem sie regelmässig zum Briefkasten vor der Wohngruppe gehen und nachsehen wollte, ob etwas drin ist. Wenn sich etwas im Briefkasten befand, musste dieser sofort geleert werden, wofür man einen Schlüssel holen musste. Andernfalls begann sie zu schreien, sich selbst zu verletzen, indem sie sich den Kopf an die Wand schlug, oder auch Mitarbeitende und andere Klient:innen zu kneifen und zu schlagen versuchte. Dieses Verhalten begann sie auch zu Hause zu zeigen und beeinflusste dort teilweise den gesamten Alltag, da sie in jeder Situation zum Briefkasten gehen musste. Die Häufigkeit nahm von 2–3-mal am Tag bis zu fast alle zehn Minuten zu.
In Absprache zwischen Mutter und Bezugsperson erhielt die PSA der Gruppe den Auftrag, dass die Klientin nur noch zu zwei bestimmten Zeiten zum Briefkasten darf: einmal, wenn sie von der Schule zurückkommt und sowieso am Briefkasten vorbeiläuft, und ein weiteres Mal am Nachmittag. Dies wurde ihr auch kommuniziert. Die PSA konnte den Auftrag nachvollziehen, da das Verhalten eine Störung jeglicher Alltagssituationen darstellte und auch andere Klient:innen oder zu Hause die Familie betraf. Auch wurde die Situation für die Klientin immer stressiger, je öfter der Tick auftrat. Die PSA hatte bereits zuvor versucht, solche Ticks bei ihr zu unterbinden, um es auch ihr danach wieder einfacher zu machen. Trotzdem war es schwer, ihr das teilweise zu verweigern, insbesondere, als sie begann, sich selbst zu verletzen. Sie schrie teilweise eine Stunde lang, und es war belastend für die PSA, sie so zu sehen. Die PSA versuchte, sie abzulenken und mit ihr Spiele zu spielen, jedoch half vieles nicht. Auch das Visualisieren auf dem UK-Plan (Unterstützung und Kommunikation) erwies sich als wenig hilfreich. Die PSA war nicht immer überzeugt, ob es richtig war, ihr den Briefkasten zu verweigern, und wurde sehr unsicher im Handeln, was die KL sicherlich auch gespürt hat. Auch empfand die PSA Druck seitens der Bezugsperson, da sie oft kommentierte, dass sie die einzige sei, die die Regeln bezüglich dieser Klientin strikt durchsetze und es dadurch nur schwieriger werde.
Mit der Zeit wurde es zum Glück viel einfacher, und die PSA verstand die Situation besser. Auch das Visualisieren auf dem UK-Plan konnte die KL dann allmählich verstehen.
Relationierung
Die PSA hat eine Vielzahl von Herausforderungen im Umgang mit Fremdbestimmung erlebt. Diese hängen sowohl von den persönlichen Erfahrungen der PSA als auch von der Zumutbarkeit für die Eigenständigkeit der Klient:innen ab. In der Situation zeigt sich, dass die Eigenständigkeit der KL gewissermassen eingeschränkt ist. Dies liegt daran, dass die PSA aufgrund früherer Ereignisse weiss, dass entweder nicht alle Gesundheitsinformationen zurück zum sozialpädagogischen Team gelangen oder dass die KL verspätet oder gar nicht von Terminen zurückkehrte.
Die Umsetzung von Regeln und Anweisungen, insbesondere gegen den Widerstand und den Willen der KL, erfordert ein sensibles Abwägen der Verhältnismässigkeit und eine klare Begründung für die Notwendigkeit der Regel. Die PSA befand sich in einem Spannungsfeld, da sie die gesetzten Grenzen der KL gut nachvollziehen konnte und mit sich rang, ob sie der KL doch die Chance geben sollte, selbstständig zum Termin zu gehen. Andererseits hatte die PSA den Auftrag, die KL zu begleiten, was auch für andere Termine vereinbart worden war. Angesichts der Einschätzung der Fähigkeiten der KL wusste die PSA, dass es in dieser Situation sinnvoller und verantwortungsbewusster wäre, die Regel durchzusetzen und die KL zu begleiten. Daher entschied sich die PSA, keinen Spielraum bei dieser Entscheidung zu lassen. Sie gab der KL zwar Raum, um ihre Bedenken zum Ausdruck zu bringen, beharrte jedoch gleichzeitig darauf, sie zu begleiten.
Die PSA war zudem verunsichert, da sie generell das Durchsetzen von Regeln, insbesondere mit welchen Mitteln und zu welchem Preis der Einschränkung der Selbstbestimmung, hinterfragte. Dies führte dazu, dass sie zwar kognitiv mit dem institutionellen Auftrag und der Vereinbarung einverstanden war, jedoch nicht wusste, wie sie die KL dazu bringen sollte, dem zu folgen, ohne ihre Macht auszuspielen und gleichzeitig das Gefühl, die eigenen Grenzen wahren zu können, nicht zu überschreiten.
Aus den obigen Erfahrungen wird deutlich, dass es wichtig ist, Regeln zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen, wenn sie nicht mehr passend erscheinen. Dabei ist es entscheidend, den Zweck der Regel zu verstehen und zu klären, ob sie ausschliesslich um ihrer selbst willen oder für einen übergeordneten, lernfördernden Zweck gilt. In dieser Situation wird deutlich, dass die Regel einem übergeordneten Zweck dient, der bereits im Vorfeld mit der KL vereinbart und besprochen wurde und sowohl der PSA als auch der KL bewusst war.
Gerade in Momenten, in denen Widerstand seitens der Klient:innen aufkommt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die PSA hinter dem Auftrag steht. Dies wird oft durch den Berufskodex und die ethische Haltung der PSA bestimmt, die darauf abzielen, Partizipation zu fördern, Empowerment zu ermöglichen und die Selbstbestimmung der Klient:innen zu respektieren. Die PSA muss sich bewusst sein, dass ihr eigenes Urteil nicht über dem der Klient:innen steht und dass Missbrauch von Macht vermieden werden muss. Es ist daher wichtig, die Meinung und Gedanken der Klient:innen zu respektieren und sie in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.
In der Situation hat die PSA versucht, auf die KL einzugehen, ihr mit Respekt zu begegnen und ihr trotz Zeitdruck zuzuhören. Die PSA wollte einen Machtmissbrauch vermeiden und ihre ethische Haltung vertreten, die Selbstbestimmung der KL zu ermöglichen. Die Gleichzeitigkeit, nach dem Berufskodex zu handeln und den Auftrag gegen den Willen der KL durchzusetzen, löste im Hinblick auf das knappe Zeitfenster Druck in der PSA aus.
Es wird durch die Erfahrungen deutlich, dass die KL durch wiederholtes Üben einer Begleitung mehr Selbstbewusstsein entwickeln kann und mit der Zeit die Aufgabe selbständig erfüllen kann.
In der Situation könnte daher der KL erklärt werden, dass die Begleitung schlussendlich zu mehr Selbstbestimmung führen kann. Die Erfahrungen zeigen, dass es wichtig ist, den Widerstand der KL zu verstehen und anzuerkennen als Teil einer respektvollen Haltung der PSA. Mit Zeit und Geduld können unterstützende Massnahmen, wenn nötig, auch gegen den Widerstand der KL durchgesetzt werden.
Die Erfahrungen aus den obigen Situationen unterstreichen die Bedeutung von Zeit, Geduld und Reflexion in der Arbeit mit Klient:innen. Die PSA muss in der Lage sein, ihre eigenen Werte und Prinzipien zu reflektieren und ihre Handlungen entsprechend anzupassen. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und den Familien der Klient:innen ist ebenfalls entscheidend, um angemessene Unterstützung zu gewährleisten und positive Veränderungen zu bewirken. Durch offene Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und Flexibilität können Lösungen gefunden werden, die den individuellen Bedürfnissen der Klient:innen gerecht werden.
Welche Rahmenbedingungen beeinflussen die PSA in der Diskussion mit der KL?
Institutioneller Auftrag
5.4 Organisationales und Kontextwissen – Welche Rahmenbedingungen beeinflussen mein Handeln?
Die stationäre Wohngruppe der sozialen Institution arbeitet interdisziplinär mit Sozialpädagogik, Psychotherapie, Arbeitsintegration, Behörden und Eltern zusammen. Das Ziel der Praxisorganisation ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Abbrecherkarriere in Familie, Schule und Ausbildung eine sichere und unterstützende Umgebung zu bieten. Dies beinhaltet das Etablieren eines stabilen Alltagsrhythmus, das Bereitstellen stabilisierender Beziehungsangebote sowie die Unterstützung beim Eintritt in die Arbeitswelt, der sozialen Integration und der Suche nach Ausbildungsplätzen. Zusätzlich bietet die Institution psychologische Hilfestellungen und fördert lebenspraktische Fähigkeiten bis zur Eigenständigkeit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung vorhandener Kompetenzen und Ressourcen zur erfolgreichen Bewältigung des Lebens.
Haltung
Die Organisation legt grossen Wert auf Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung. Sie setzt sich aktiv für soziale Gerechtigkeit ein, unabhängig von Weltanschauung, Nationalität und Kultur, und verpflichtet sich den Allgemeinen Menschenrechten.
Die Haltung gegenüber den Klient:innen vereint den aktiven Zuspruch von Anerkennung und Wertschätzung mit Interventionen, die herausfordernde Aktivierung und begrenzende Konfrontation beinhalten. Ein übergeordneter Fokus liegt auf beziehungsorientierten Interventionen, die dem jungen Menschen emotionale Sicherheit, Kontinuität und neue positive Beziehungserfahrungen bieten sowie die Motivation stärken und den Erwartungshorizont erweitern.
Die Institution bleibt ihrem Anspruch treu, auch für „schwierige“ Klient:innen ein tragender Ort zu sein. Dabei wird das Beziehungsangebot in belastenden Situationen aufrechterhalten, Abbrüche werden aktiv vermieden, und Ausschlüsse als schnelle institutionelle Entlastungen dienen nicht als Lösung für Probleme.
Grundlagenkonzepte
Die Grundlagenkonzepte umfassen die (Rechte und) Pflichten sowohl der Bewohnenden als auch der Institution und ihrer Mitarbeitenden.
Pflichten der Bewohnenden:
Hausregeln und ihre Konsequenzen bei Regelbruch, Kooperationsbereitschaft, obligatorischer Psychotherapiebesuch, Pflichten im Haushalt, Eingliederung und Anwesenheit in Arbeitsintegration/Schule, Auskunftspflicht, Teilnahme an internen Sitzungen und Unternehmungen (Haussitzung, wöchentlicher Ausflug), Abmachungen einhalten, die am Standortgespräch vereinbart wurden etc.
Pflichten der Institution:
Fürsorgepflicht, Melde- und Auskunftspflicht, Vertraulichkeit und Datenschutz, Schutz vor Diskriminierung und Missbrauch, Bewohnende über ihre Rechte informieren, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Gewährleistung einer sicheren und unterstützenden Umgebung, Bereitstellung von angemessener Betreuung, Therapie und Bildung, Förderung von Partizipation, Mitbestimmung und Selbstbestimmung, kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung der Qualität der Betreuung und Unterstützung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ethischer Standards und institutioneller Richtlinien etc.
Weitere Konzepte:
Betreuungskonzept, Bezugspersonenarbeit, Rechte/Pflichten der Institution (Obhutspflicht), Case Management, Ansatz der lebensorientierten Sozialen Arbeit und Vorgehen nach KPG, Kommunikation mit Eltern, Beziehungsberechtigten oder externen Behörden (KESB etc.), Zusammenarbeit mit KESB/Beistandschaften, Schweigepflichtserklärung, Vorgehen bei Notfällen, Zugang zu bestimmten Bereichen der Wohngruppe (Mädchen-Jungs-Stock, Büro, Rauchbereich etc.), Abhalten von regelmässigen Standortgesprächen, Ruhezeiten, Essenszeiten, Aufnahmeverfahren etc.
5.5 professionelle Fähigkeiten – Was muss ich als professionelle Fachperson können?
Was muss die PSA können, um sich im Spannungsfeld zwischen den Grenzen des organisationalen Auftrags, der persönlich-professionellen Haltung und dem Anliegen der KL professionell bewegen zu können?
Die nachfolgenden Fähigkeiten sind für die PSA in Konfliktsituationen im sozialpädagogischen Alltag von Bedeutung:
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die PSA kann sich an verschiedene Situationen flexibel anpassen und auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen, ohne dabei die Grenzen des Auftrags zu überschreiten.
- Offenheit für Inputs von aussen: Die PSA ist offen für Inputs und Ideen von anderen Fachpersonen und bemüht sich, diese zu integrieren.
- Kommunikationsfähigkeiten: Die PSA kann klar, präzise und verständlich kommunizieren. Sie kann aktiv zuhören und gezielt nachfragen, um die Bedenken und Anliegen der Klient:innen zu verstehen und dabei die Grenzen des organisationalen Auftrags zu vermitteln.
- Empathie und Einfühlungsvermögen: Die PSA ist einfühlsam und kann sich in die Lage der Klient:innen versetzen, um ihre Anliegen und Bedürfnisse besser zu verstehen und angemessen zu reagieren. Dabei hat sie eine zugewandte und wertfreie Haltung gegenüber den Klient:innen.
- Ethik und Berufsethik: Die PSA hat ein Verständnis für ethische Grundsätze und berufliche Standards und stellt sicher, dass ihr Handeln mit diesen Normen und Werten übereinstimmt.
- Kritische Reflexionsfähigkeit: Die PSA reflektiert kritisch ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen und passt diese gegebenenfalls an, um im besten Interesse der Klient:innen und im Rahmen des Auftrags zu handeln.
- Teamarbeit und Zusammenarbeit: Die PSA arbeitet aktiv mit anderen Fachkräften zusammen, um gemeinsame Lösungen zu finden und die bestmögliche Unterstützung für die Klient:innen zu gewährleisten.
- Abgrenzungsfähigkeit: Die PSA kennt ihre eigenen Grenzen und Kapazitäten und steht dafür gegenüber den Klient:innen und dem Team ein.
- Präsenz: Die PSA ist präsent und nimmt aktiv an den Geschehnissen teil.
- Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein: Die PSA hat Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ist sich ihrer Rolle bewusst.
- Geduld und Kreativität: Die PSA bewahrt auch in längeren oder herausfordernden Situationen Ruhe und probiert kreative Ansätze aus, um Lösungen zu finden.
- Beziehungsfähigkeit: Die PSA ist in der Lage, positive und unterstützende Beziehungen zu den Klient:innen aufzubauen und zu pflegen. Sie kann eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in der sich die Klient:innen sicher und respektiert fühlen.
- Partizipation: Die PSA bezieht Klient:innen aktiv in Entscheidungsprozesse ein und respektiert ihre Meinungen, Bedürfnisse und Präferenzen. Sie ermutigt die Klient:innen, an der Planung und Umsetzung von Aktivitäten und Interventionen teilzunehmen und nimmt ihre Meinungen und Ideen ernst.
Relationierung
In der beschriebenen Situation hat die PSA gezeigt, dass sie über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügt, indem sie versucht hat, die Bedenken der KL zu verstehen und ihre eigenen Überlegungen klar zu kommunizieren. Sie hat einfühlsam reagiert und die Anliegen der KL respektiert, indem sie betont hat, dass sie deren Privatsphäre respektieren möchte. Trotzdem könnte sie möglicherweise flexibler und partizipativer sein, indem sie alternative Lösungen vorschlägt oder gemeinsam mit der KL ausarbeitet, um die Bedürfnisse der KL zu erfüllen, ohne dabei den organisationalen Auftrag zu vernachlässigen. Es wäre auch wichtig gewesen, dass die PSA ihre Präsenz und Selbstwirksamkeit stärker zeigt, indem sie bestimmt darauf besteht, dass die KL und sie einen anderen Raum aufsuchen, um die Diskussion fortzuführen. Letztendlich hat die PSA die PA um Hilfe gebeten, was zeigt, dass sie erkannt hat, dass sie in dieser Situation allein nicht weiterkommt.
Des Weiteren könnte die Situation die Geduld und Kreativität der PSA auf die Probe gestellt haben. Trotz ihrer Bemühungen, eine Lösung zu finden, zeigte die KL weiterhin Widerstand. Dies erfordert Geduld, um weiterhin ruhig und einfühlsam zu bleiben, sowie Kreativität, um alternative Wege zu finden, um die Bedürfnisse der KL zu erfüllen, ohne dabei den organisationalen Auftrag zu vernachlässigen. Es scheint jedoch, als wären der PSA die Ideen schnell ausgegangen. Aufgrund der begrenzten Zeit und der überrumpelnden Situation lässt sich ableiten, dass die PSA möglicherweise nicht genügend alternative Lösungsansätze in Betracht gezogen hat. Um die Situation effektiv zu bewältigen, hätte die PSA möglicherweise mehr kreative Lösungsansätze einsetzen können.
Es könnte auch ein innerer Konflikt bezüglich Ethik und Berufsethik entstanden sein. Die PSA musste abwägen, was auch aus der Reflection in Action hervor geht, wie sie die Autonomie und Privatsphäre der KL respektiert, während sie gleichzeitig sicherstellt, dass die organisatorischen Anforderungen erfüllt werden, wie beispielsweise die Kommunikation von Gesundheitsinformationen. Dies erfordert eine kritische Reflexionsfähigkeit, um zu überlegen, ob das Handeln im Einklang mit den ethischen Grundsätzen und beruflichen Standards steht.
Die Abgrenzungsfähigkeit der PSA könnte ebenfalls herausgefordert worden sein, insbesondere wenn die KL und die BW keine Bereitschaft zeigten, der Bitte der PSA nachzukommen. Hier könnte die PSA möglicherweise Schwierigkeiten gehabt haben, ihre eigenen Grenzen zu wahren und ihre Autorität durchzusetzen.
Schliesslich könnte die Beziehungsfähigkeit der PSA beeinträchtigt worden sein, da die KL und die BW sich nicht auf die Vorschläge der PSA eingelassen haben. Dies könnte die Fähigkeit der PSA beeinträchtigen, positive und unterstützende Beziehungen zu den Klient:innen aufzubauen und zu pflegen, was sich wiederum auf die Effektivität ihrer Arbeit auswirken könnte. Es lässt sich auch interpretieren, dass die PSA und die KL noch keine stabile Beziehung hatten aufbauen können, da sie sich noch nicht lange genug kannten.
5.6 Organisationale, infrastrukturelle, zeitliche und materielle Voraussetzungen – Womit kann ich handeln?
Die unten aufgeführten Voraussetzungen werden auch im Kapitel 5.1.1 erwähnt und wiederholen sich teilweise.
Die institutionellen Rahmenbedingungen setzen die Kooperationsbereitschaft der KL mit den PSA voraus. Darüber hinaus liegt eine Obhutspflicht bei der Institution, die von professionellen Fachkräften umgesetzt wird. Dies bedeutet, dass die Institution die Hauptverantwortung für die Sicherheit trägt. Sie muss über aktuelle sowie neue Informationen bezüglich der Gesundheit der Klienten verfügen und darauf zugreifen können. Zusätzlich wurde bei einem Standortgespräch vereinbart, dass die Begleitung durch eine Fachkraft zu externen Terminen, insbesondere zu ärztlichen Besuchen, obligatorisch ist (s. Situationsbeschreibung).
Die zeitlichen Ressourcen sind insofern begrenzt, da nur wenig Zeit bis zum geplanten Aufbruch zur Tramstation bleibt. Dieser Zeitdruck kann dazu führen, dass die PSA bestrebt ist, die Diskussion schnell zu beenden, um den Zeitplan einzuhalten. Die Art der Intervention seitens der PA, um die Situation aufzulösen, könnte ebenfalls auf den Zeitdruck zurückzuführen sein. Den Diskussionsraum zu unterbinden und die nächste Handlung autoritär zu bestimmen, zeigt sich in dieser Situation als effiziente und zeitsparende Intervention.
Eine weitere Ressource ist das Personal. In dieser Situation wurde bewusst die PSA für die Begleitung zum Termin gewählt, da der Beziehungsaufbau mit der KL gefördert werden soll und andere sozialpädagogische Fachkräfte anderweitig beschäftigt sind. Daher kommt keine andere sozialpädagogische Fachkraft in Frage.
Zu den materiellen Ressourcen gehören Transportmittel, finanzielle Ressourcen und die Krankenkassenkarte. Das Transportmittel ist festgelegt auf öffentliche Verkehrsmittel, da die KL ein Abonnement für diese Zonen hat. Finanzielle Ressourcen sind grundsätzlich nicht relevant, damit die PSA die Abmachung, die KL zum Termin zu begleiten, einhalten kann. Finanzielle Möglichkeiten für Verpflegung bestünden jedoch. Die Krankenkassenkarte trägt die KL bei sich, was von der PSA im Vorherein nachgefragt wurde.
5.7 Wertewissen – Woraufhin richte ich mein Handeln aus? Welches sind die zentralen Werte in dieser Situation, die ich als handelnde Fachperson berücksichtigen will?
Welche Werte sind für die PSA in der Situation handlungsleitend? Insbesondere wenn sich PSA und KL nicht einigen können?
Berufskodex der Sozialen Arbeit – AvenirSocial
Der Berufskodex dient Sozialarbeitenden als Leitfaden, um ihre Arbeit auf ethische Weise zu begründen. Er legt ethische Richtlinien und Werte fest, die das moralische berufliche Handeln in der Sozialen Arbeit unterstützen. Durch den Berufskodex können Sozialarbeitende ihre Berufsauffassung entwickeln und Prinzipien des professionellen und ethischen Handelns vertreten. Der Berufskodex basiert auf internationalen Übereinkommen der UNO und betont daher die Bedeutung von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit für die Soziale Arbeit (vgl. AvenirSocial 2010: 5-9).
Aus der Achtung der Menschenwürde und den Menschenrechten ergeben sich folgende Grundwerte:
- Gleichbehandlung
- Selbstbestimmung
- Partizipation
- Integration
- Ermächtigung
- Wertschätzung
- Vertrauen
- Gerechtigkeit
Zur sozialen Gerechtigkeit gehören die Verpflichtung zur Zurückweisung von Diskriminierung, Anerkennung von Verschiedenheiten, gerechten Verteilung von Ressourcen, Aufdeckung von ungerechten Praktiken und die Einlösung von Solidarität (vgl. ebd.: 9-11).
„Handlungsmaximen [aus dem Berufskodex]
bezüglich der eigenen Person:
- Die PSA respektieren stets den Wert und die Würde ihrer eigenen Person, um so auch anderen gegenüber mit demselben Respekt begegnen zu können.
- Die PSA gehen verantwortungsvoll mit dem Machtgefälle zwischen ihnen und ihren Klientinnen und Klienten um und sind sich der Grenzen ihrer eigenen Kompetenzen bewusst.
- Die PSA sind sich ihrer Positionsmacht bewusst und gehen damit sorgfältig um.
bezüglich der Arbeit mit Klient:innen:
- Die PSA achten bei aller beruflichen Routine darauf, durch reflektierte und zugleich kontrollierte empathische Zuwendung die Persönlichkeit und Not des oder der Anderen eingehend wahrzunehmen und sich gleichwohl gebührend abzugrenzen.
- Die PSA fordern bei aller Bestärkung ihrer Klientinnen und Klienten in der Wahrnehmung ihrer Rechte auch deren Pflichten ein.
- Die PSA stellen an ihre Klientinnen und Klienten nur fachlich adäquate und ethisch begründete Anforderungen.
bezüglich den Organisationen des Sozialwesens:
- Die PSA verpflichten sich gegenüber ihren Arbeitgebenden zur sorgfältigen Erfüllung ihrer Aufgaben gemäss den Normen und Prinzipien des Berufskodexes und setzen sich dafür ein, dass diese von der Organisation, in der sie arbeiten, respektiert und eingehalten werden.
- Die PSA sprechen allfällige Zielkonflikte oder ethische Differenzen zwischen ihnen und der Organisation, in der sie arbeiten, an und versuchen, im Sinne des Berufskodexes Lösungen zu finden. Sie pflegen und fördern in ihrer Organisation den Dialog über die Ethik Sozialer Arbeit.
bezüglich der eigenen Profession:
- Die PSA berufen sich in ihrer Analyse explizit auf das Wissen ihrer Profession. Sie stützen sich in ihren Handlungsentscheidungen auf deren ethische Grundlagen.
- Die PSA führen untereinander einen kontinuierlichen fachlichen Diskurs, sie kontrollieren systematisch, kollegial und in Zusammenarbeit mit der Forschung ihre Facharbeit und setzen sich
mit Fehlern kritisch auseinander. - Die PSA machen sich gegenseitig auf Abweichungen oder Alternativen bezüglich eines korrekten methodischen Vorgehens aufmerksam und verlangen voneinander gegenseitig die Einhaltung ethischer, berufs-, bildungs- und sozialpolitischer Forderungen ihrer Profession.
- Die PSA anerkennen und vertreten die Formulierungen dieses Berufskodexes […].
bezüglich der interprofessionellen Kooperation:
- Die PSA kooperieren im Hinblick auf die Lösung komplexer Probleme interdisziplinär und setzen sich dafür ein, dass Situationen möglichst umfassend und transdisziplinär in ihren Wechselwirkungen analysiert, bewertet und bearbeitet werden können.
- Die PSA sind in der interprofessionellen Kooperation für wissenschaftsbasiertes methodisches Handeln besorgt, d.h. sie fordern die Einhaltung von Regeln zur Steuerung einer geordneten Abfolge von Handlungen und die Koordination und Kontrolle der Interventionen innerhalb und ausserhalb der Organisationen ein.“
(AvenirSocial 2010: 12-15)
Relationierung
In der beschriebenen Situation gelang es der PSA, die Ethik und Berufsethik zu wahren, indem sie respektvoll mit der KL interagierte und versuchte, ihre Bedenken zu verstehen, ohne dabei ihre eigenen professionellen Grenzen zu überschreiten. Die PSA zeigte auch eine kritische Reflexionsfähigkeit, indem sie die Situation analysierte und alternative Handlungsmöglichkeiten in Betracht zog, um das Problem zu lösen. Allerdings konnte die PSA ihre Abgrenzungsfähigkeit nicht vollständig wahren, da sie möglicherweise zu stark auf die Beziehung zur KL fixiert war und durch den inneren Konflikt Schwierigkeiten hatte, den institutionellen Auftrag durchzusetzen, da dies dem Bedürfnis, die Autonomie der KL zu wahren, widerspricht. Womöglich fühlte sich die PSA verpflichtet, die Meinung und Bedürfnisse der KL zu unterstützen, anstatt klar zu kommunizieren, welche Grenzen sie setzen musste, um die Aufgaben gemäss den professionellen Standards zu erfüllen. Die PSA respektierte die Autonomie der KL und versuchte, sie in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, indem sie ihre Anliegen ernst nahm und alternative Lösungen vorschlug. Trotzdem blieb die PSA konsequent bei den ethischen Grundlagen des Berufskodexes und versuchte, eine ausgewogene Balance zwischen den Bedürfnissen der KL und den professionellen Standards zu finden. Das zeigte sich darin, dass die PSA auf der Abmachung beharrte und bis zum Schluss nicht nachgab. Als die Handlungsalternativen erschöpft waren, holte sie die PA zur Hilfe.
In Bezug auf die Selbstbestimmung könnte argumentiert werden, dass die Bemühungen der PSA, den Konflikt durch Argumentation zu lösen, möglicherweise nicht ausreichten, um die Selbstbestimmung der KL ausreichend zu fördern. Der PSA ist bewusst, dass die Selbstbestimmung der KL in diesem Moment verletzt wird, wenn sie den Auftrag, die KL zu begleiten gegen ihren Willen durchzieht. Das löst bei der PSA eine Entscheidungsunsicherheit und ein Spannungsfeld zwischen Förderung der Autonomie und dem langfristigen Wohl und Lerneffekt der KL aus. Es ist anzumerken, dass die PSA dabei vermied autoritär zu agieren und Macht auszuüben, wie es beispielsweise die PA tat, indem sie die Entscheidung fremdbestimmt traf und die PSA und KL zum Gehen aufforderte. Im Gegensatz zur PSA scheint die PA eine klare Haltung zu zeigen, in der sie sich gegen die Förderung der Autonomie der KL entscheidet.
Die Partizipation kam teilweise zu kurz. Sie ist abhängig von der Grösse des Handlungsspielraums, welcher der jeweilige Auftrag sowie Kontext beinhalten. Zwar hat die PSA die KL in den Diskussionsprozess einbezogen und beiden Raum gegeben, ihre Bedenken zu äussern, doch sie hätte aktiver versuchen können, die KL und möglicherweise auch die BW stärker in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dadurch hätten sich alle Beteiligten gehört und respektiert gefühlt und gemeinsam zu einer bestmöglichen Lösung beitragen können.
In Bezug auf die Gleichbehandlung könnte argumentiert werden, dass die PSA möglicherweise nicht ausreichend darauf geachtet hat, die Bedenken und Meinungen der BW angemessen zu berücksichtigen. Eine zu starke Einbeziehung der anderen Bewohnerin könnte die Interaktion zwischen der PSA und der KL jedoch auch beeinträchtigen und den Lösungsprozess verkomplizieren. Hier wäre es wichtig eine angemessene Balance zu finden, die BW in gewissen Massen einzubeziehen, aber den Fokus dennoch hauptsächlich auf die Bedürfnisse und Anliegen der KL zu richten. Das abrupte Auflösen der Situation könnte bei der BW das Gefühl ausgelöst haben, ungleich behandelt zu werden.
- Die Regeln, Rahmenbedingungen, Vorgaben der Institution sind klar kommuniziert
- Falls PSA Regeln, Rahmenbedingungen, Vorgaben mit ihren professionsethischen Werten nicht (mehr) vereinbaren können, thematisieren sie dies im Team, damit es für eine Weiterentwicklung genutzt werden kann
- Der Gleichbehandlung gegenüber den anderen Klient*innen wird Rechnung getragen
- Die Konsequenzen werden von der/dem PSA transparent gemacht
- Die Gestaltung der Situation als Lernsituation steht im Vordergrund, nicht das Durchsetzen bestimmter Verhaltensweisen.
- Nach einem Regelverstoss ermöglicht die PSA der Klientel, die Sinnhaftigkeit der Regeln nachvollziehen zu können und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass Regeln künftig eingehalten werden können
- Die von den PSA ausgesprochenen Konsequenzen stehen in einem logischen Zusammenhang zum Regelverstoss
- In der Situation begegnen die PSA der Klientel mit einer wertschätzenden Haltung, was bedeutet, dass der Mensch und das Verhalten getrennt werden. Die PSA bleiben offen und unvoreingenommen.
- Die Klientel fühlt sich trotz Fehlverhalten akzeptiert
- Die PSA kommuniziert das Spannungsfeld, indem sie sich befindet, transparent gegenüber der Klientel und im Team.
- Herausfordernde Situationen werden zur Nachbesprechung ins Team getragen.
- Die Regeln, Rahmenbedingungen, Vorgaben der Institution sind klar kommuniziert
Erfüllt: Bei Eintritt in die Institution wurde der KL mitgeteilt, dass die PSA gemeinsam mit der PA die Bezugspersonen der KL sind. Schon im ersten Standortgespräch wurde vereinbart, dass die PSA alle Termine der KL organisieren und die KL zu allen Terminen begleiten soll. Der Zweck dieser Regelung, welcher die PSA der KL gegenüber formulierte, ist, eine Beziehung aufzubauen und die 16-jährige KL im Alltag zu unterstützen. Zwischenzeitlich wurde der KL die Möglichkeit gegeben, zwei bis drei externe Termine selbstständig wahrzunehmen. Der KL gelang es nicht ihr Können unter Beweis zu stellen, da sie unpünktlich oder gar nicht zum Termin erschien, danach länger, teilweise tagelang der Institution fern blieb und die für die Arbeit in der Institution relevanten (u.a. gesundheitlichen) Informationen von der KL nicht ins sozialpädagogische Team zurückgetragen wurden, auch nicht bei Nachfrage. Im letzten Standortgespräch vor der beschriebenen Situation wurden die allgemeingültigen Regeln wiederholt thematisiert sowie neue individuell-geltende Vereinbarungen getroffen. Diese wurden in einem Protokoll festgehalten und allen an der Sitzung beteiligten Personen zugänglich gemacht. Zudem wurde der KL mindestens ein Tag vor dem Termin von der PSA per WhatsApp die ÖV-Verbindung geschickt sowie der Treffpunkt und die Uhrzeit vereinbart. Dass die KL pünktlich wie abgesprochen bereit gestanden zu haben schien, weist darauf hin, dass der KL die Vereinbarung bewusst war.
- Falls PSA Regeln, Rahmenbedingungen, Vorgaben mit ihren professionsethischen Werten nicht (mehr) vereinbaren können, thematisieren sie dies im Team, damit es für eine Weiterentwicklung genutzt werden kann
Nicht erfüllt: Die PSA hat ihr entstandenes Anliegen aus der Situation nicht nachträglich im Team besprochen. Im Allgemeinen wird in dem sozialpädagogischen Team selten über die gemeinsame Haltung gesprochen oder reflektiert. Erst bei mehrmaligem Aufstand seitens Klientel oder Mitarbeitenden werden Regeln hinterfragt oder angepasst. Daher bestand für die PSA eine Hürde, dieses Ereignis ins Team zu bringen und gemeinsam zu reflektieren.
- Der Gleichbehandlung gegenüber den anderen Klient*innen wird Rechnung getragen
Bedingt erfüllt: Aus dieser konkreten Situation lässt sich keine direkte Ungleichbehandlung zwischen der BW und der KL ableiten. Im Gespräch wurde zwar die BW von der PSA nicht aktiv mit eingebunden, da die PSA dies für den Prozess als nicht förderlich bewertet hat. Die PSA hat sich bewusst dazu entschieden nur die KL zu adressieren und nicht auf die wiederholenden Argumente der BW einzugehen, da der Fokus in der Situation auf der KL lag und nichts konkret mit der BW zu tun hatte. Die BW könnte sich jedoch ungleich behandelt gefühlt haben, da sie die PSA aktiv versucht hat wegzuschicken, und sich nach Auflösung der Situation niemand um die BW gekümmert hat.
Langfristig gesehen ist eine Gleichbehandlung in der Institution schwer umzusetzen, da alle Bewohnenden über unterschiedliche Fähigkeiten und Ressourcen verfügen. Dies führt dazu, dass nicht alle Regeln für alle Bewohnenden gleichermassen gelten, da sie teilweise länger brauchen ihren Pflichten nachzukommen, mehr Unterstützung benötigen oder sehr selbstständig und pflichtbewusst sind. So werden Regelungen individuell angepasst, was bei anderen Bewohnenden zu einem Gefühl von Ungleichbehandlung führen kann.
- Die Konsequenzen werden von der/dem PSA transparent gemacht
Eher nicht erfüllt: In der Situation werden nur die Konsequenzen für die Weiterarbeit im sozialpädagogischen Team bei fehlenden Gesundheitsinformationen kommuniziert. Mögliche Konsequenzen, wenn sich die KL nicht von der PSA begleiten lässt, werden nicht explizit angesprochen. Es wird nicht erwähnt, ob die PSA in Betracht zieht, die KL alleine zum Termin gehen zu lassen.
Langfristige Konsequenzen bei Nicht-Einhalten der Vereinbarungen, wie beispielsweise eine Einschränkung des Wochenendausgangs oder der Ferien, wurden während des Standortgesprächs festgelegt, jedoch wurden sie in der aktuellen Situation nicht erneut thematisiert.
- Die Gestaltung der Situation als Lernsituation steht im Vordergrund, nicht das Durchsetzen bestimmter Verhaltensweisen.
Teilweise erfüllt: Obwohl die PSA keinen expliziten Lernraum geschaffen hat, entstand durch ihre Haltung, auf die KL einzugehen und nicht einfach den Auftrag durchzusetzen, eine natürliche Lernsituation während der Diskussion. Hierbei war das Lernfeld der KL, in Beziehung zur PSA zu treten, für ihre eigenen Werte und Grenzen einzustehen und einen entstehenden Konflikt konstruktiv zu lösen. Die PSA ermöglichte einen Dialog auf Augenhöhe, einen kontinuierlichen Austausch und ein unterstützendes Beziehungsangebot, was der KL das Gefühl von Selbstbestimmung gab, indem sie ihre eigenen Gefühle ausdrücken und aussprechen konnte.
Andererseits steckt auch eine Lerngelegenheit hinter der Durchsetzung der Regel. Durch die Begleitung der PSA soll die KL Vertrauen zur PSA aufbauen, lernen, einen Termin selbstständig und pünktlich wahrzunehmen und dabei alle wichtigen Informationen für das sozialpädagogische Team zurückzumelden.
Ob der PA sich der einen oder der anderen potenziellen Lerngelegenheit bewusst war, bleibt unklar. Jedoch scheint es aufgrund der Art und Weise, wie der PA intervenierte, eher darum zu gehen, die Situation schnell zu lösen und ein bestimmtes Verhalten, nämlich das Nicht-Diskutieren, durchzusetzen. Es ist nicht klar, ob der PA bewusst war, dass dies die Lernmöglichkeiten für die KL und die PSA unterbrochen oder verhindert hat.
- Nach einem Regelverstoss ermöglicht die PSA der Klientel, die Sinnhaftigkeit der Regeln nachvollziehen zu können und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass Regeln künftig eingehalten werden können
Teilweise erfüllt: Die PSA argumentiert mittel- bis kurzfristig und nicht langfristig, dass es nun wichtig sei, gemeinsam mit der KL zum Termin zu erscheinen und nimmt Bezug auf das letzte erfolgreiche Begleiten. Dies ermöglicht der KL, die Sinnhaftigkeit der Regeln nachzuvollziehen. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Regeln künftig eingehalten werden, nicht gesichert. Die Diskussion war am Ende nicht zielführend und scheint bei der KL keine Einsicht ausgelöst zu haben. Das autoritäre Auflösen der Situation durch die PA könnte zudem eher kontraproduktiv wirken, da in dieser Situation kein klarer Regelverstoss vorliegt. Es könnte eher dazu führen, dass die Motivation der KL zur zukünftigen Einhaltung der Regel verringert wird, da die Regel lediglich aus Angst vor Bestrafung befolgt werden könnte und nicht aus Einsicht oder Überzeugung. Dies könnte langfristig die Einhaltung der Regeln gefährden.
- Die von den PSA ausgesprochenen Konsequenzen stehen in einem logischen Zusammenhang zum Regelverstoss
Trifft nicht auf Situation zu: In dieser spezifischen Situation wurden keine Konsequenzen ausgesprochen, da der Regelverstoss selbst noch nicht geschehen ist. Die Regelverstösse fanden Wochen zuvor statt und sind daher nicht relevant für die aktuelle Diskussion oder Interaktion zwischen der KL und der PSA. Somit kann man nicht sagen, dass die Konsequenzen in dieser Situation einen logischen Zusammenhang zum Regelverstoss haben, da dieser in der gegenwärtigen Situation nicht stattgefunden hat.
- In der Situation begegnen die PSA der Klientel mit einer wertschätzenden Haltung, was bedeutet, dass der Mensch und das Verhalten getrennt werden. Die PSA bleiben offen und unvoreingenommen.
Erfüllt: Die PSA hört der KL aufmerksam zu und versucht auf sie und ihre Äusserungen einzugehen. Die PSA scheint mit der Zeit angespannt und etwas genervt zu sein, wobei dies auf den Zeitdruck und das Gefühl die Situation nicht alleine bewältigen zu können zurückzuführen ist und nicht auf das Verhalten der KL an sich. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Offenheit der PSA zielführend war, um die Regel durchzusetzen. Im Vergleich zur PSA hat die PA, durch ihre konsequente Haltung und das autoritäre Bestimmen des weiteren Vorgehens, zwar keine Offenheit gezeigt, ist jedoch schneller zum Ziel gekommen, die Vereinbarung einzuhalten. Die PSA war insofern voreingenommen, als sie aufgrund der bisherigen Erfahrungen bezüglich der Fähigkeiten der KL, selbstständig zum Termin zu gehen, davon ausging, dass ihr das nicht gelingen würde. Zudem hat die institutionelle Vereinbarung dazu beigetragen, dass die PSA nicht in Erwägung gezogen hat, dem Wunsch der KL nachzukommen, den Termin alleine oder mit der BW wahrzunehmen.
- Die Klientel fühlt sich trotz Fehlverhalten akzeptiert
Erfüllt: In dieser Situation könnte auch ihr früheres Fehlverhalten gemeint sein, wie das Nicht-Erscheinen zu Terminen oder das unzuverlässige Zurückspielen wichtiger Informationen. Die PSA reagiert darauf, indem sie nicht die früheren Versäumnisse der KL hervorhebt, sondern stattdessen betont, wie wichtig es ist, in Zukunft zuverlässig zu sein und sich zu verbessern. Die Nicht-Einhaltung der Absprache in dieser spezifischen Situation, in der die KL zuvor zugestimmt hatte und sich nun weigert, die Vereinbarung einzuhalten, oder möglicherweise die Nicht-Kooperation und Blockade gegenüber der PSA bei der Suche nach einer Lösung, könnte als „Fehlverhalten“ interpretiert werden. Während der Diskussion nimmt die PSA die KL ernst und geht einfühlsam auf ihre Anliegen ein. In diesen beiden Aspekten scheint sich die KL trotz ihres „Fehlverhaltens“ akzeptiert zu fühlen, da sie von der PSA nicht sanktioniert wird. Als die PA hinzukommt und das weitere Vorgehen und Verhalten bestimmt, geht sie zwar nicht explizit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und die Dynamik der bestehenden Gruppe ein, was jedoch nicht zwangsläufig dazu führt, dass sich die KL nicht akzeptiert fühlt.
Qualitätsstandard spezifischer Zusatz:
- Die PSA kommuniziert das Spannungsfeld, indem sie sich befindet, transparent gegenüber der Klientel und im Team.
Nicht erfüllt: In dieser Situation hat die PSA das Spannungsfeld und ihre eigene Unsicherheit gegenüber der KL und dem Team nicht transparent kommuniziert. Die PSA hat nicht in Erwägung gezogen, ihre Unsicherheiten im Spannungsfeld gegenüber der KL anzusprechen. Einerseits war ihr diese Möglichkeit nicht bewusst, andererseits hatte sie auch Angst, Schwäche zu zeigen und den Eindruck zu erwecken, die Situation nicht mehr im Griff zu haben. Aus Zeitgründen beschränkte sich die PSA darauf, die aktuelle Situation zu schildern, als sie die PA um Hilfe bat, ohne jedoch ihre innere Herausforderung im Spannungsfeld zwischen der Einhaltung der Absprachen und dem Respekt vor der Privatsphäre der KL anzusprechen. Auch im Nachhinein hat die PSA weder bei der KL noch im Team thematisiert, dass sie in dieser Hinsicht hin- und hergerissen war.
- Herausfordernde Situationen werden zur Nachbesprechung ins Team getragen.
Nicht erfüllt: Weder die PSA noch die PA haben die herausfordernde Situation ins Team zur Nachbesprechung getragen. Auch in den Praxisausbildungsgesprächen zwischen der PSA und der PA wurde diese Situation nicht aufgegriffen und reflektiert. (siehe Handlungsalternativen)
- Falls PSA Regeln, Rahmenbedingungen, Vorgaben mit ihren professionsethischen Werten nicht (mehr) vereinbaren können, thematisieren sie dies im Team, damit es für eine Weiterentwicklung genutzt werden kann
Die PSA sollte die entstandene Diskrepanz zwischen den professionsethischen Werten und den aktuellen Situationen im Team ansprechen. Dies könnte genutzt werden, um zu reflektieren, wie die geltenden Regeln und Rahmenbedingungen an die Bedürfnisse der KL angepasst werden könnten, während gleichzeitig die ethischen Standards aufrechterhalten werden. Es ist wichtig, gemeinsam im Team zu überlegen, wie diese Anpassungen erfolgen können und gleichzeitig die Privatsphäre der KL respektiert wird. Für eine ähnliche Situation könnte das Erstellen eines klar strukturierten Plans mit definierten Zielen für die erforderlichen Fähigkeiten zur erfolgreichen Durchführung von Terminen dazu beitragen, die Selbstständigkeit der KL zu fördern und zu stärken.
- Die Konsequenzen werden von der/dem PSA transparent gemacht
Es ist wichtig, dass die PSA die Konsequenzen der Nicht-Einhaltung der Absprache transparent kommuniziert. Die PSA könnte der KL klarmachen, dass das verspätete Erscheinen am Termin möglicherweise zu einer Konfrontation mit ihrem Gynäkologen führen könnte, der sie dann alleine überlassen ist, da die PSA im Wartezimmer bleibt. Eine weitere Konsequenz könnte beinhalten, klare Alternativen anzubieten, wie beispielsweise die Verschiebung des Termins auf einen anderen Tag. Um auch hier ein Lernfeld zu schaffen, wäre es sinnvoll, der KL die Verantwortung zu überlassen, den Termin eigenständig zu verschieben und möglicherweise einen Teil des verrechneten Betrags aufgrund der kurzfristigen Abmeldung selbst zu tragen. Nichtsdestotrotz muss der KL deutlich gemacht werden, dass es keine Option ist, dass sie den Termin ohne Begleitung der PSA wahrnimmt. Auch wenn der Termin verschoben wird, bleibt die Regelung bestehen, dass diese PSA die KL begleitet. Langfristige Konsequenzen bzw. Ziele sollten ebenfalls thematisiert werden, wie etwa die Förderung der Selbstständigkeit der KL und die Auswirkungen auf ihre Freiheiten (z. B. Wochenendausgänge, Urlaube).
- Die Gestaltung der Situation als Lernsituation steht im Vordergrund, nicht das Durchsetzen bestimmter Verhaltensweisen.
Der PSA könnte bewusster sein, die Situation als Lerngelegenheit zu betrachten, anstatt nur bestimmte Verhaltensweisen durchsetzen zu wollen. In der sozialpädagogischen Begleitung in der Lebenswelt Jugendheim sollte das Team einheitlich die verschiedenen Aspekte der professionellen Begleitung als Lernsituationen betrachten, anstatt Kontrolle und Autorität als den einzigen Weg zur Funktionalität innerhalb der begrenzten Ressourcen zu sehen, wie es oft von der PSA in der Institution wahrgenommen wird.
- Nach einem Regelverstoss ermöglicht die PSA der Klientel, die Sinnhaftigkeit der Regeln nachvollziehen zu können und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass Regeln künftig eingehalten werden können
Einbeziehen der Klientel in die Lösungsgestaltung:
Obwohl die PSA darauf besteht, die KL zu begleiten, sollte sie der KL trotzdem Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung dieses festgelegten Ziels bieten. Dies könnte beispielsweise bedeuten, dass die KL darüber entscheiden kann, ob sie sich eine Belohnung in Form eines Getränks aussuchen möchte oder ob sie im Anschluss noch kurz einen anderen Ort aufsuchen möchte. Die PSA hätte die KL auch fragen können, ob sie auf dem Weg zum Termin lieber eine Unterhaltung führen, Musik hören oder in Ruhe gehen möchte. Durch die Einbeziehung der KL in solche Entscheidungen wird ihre Autonomie gefördert und ihre Bereitschaft zur Kooperation gestärkt.
Fokusverschiebung:
Die PSA könnte von der Schwierigkeit abweichen, dass die KL nicht mit ihr gehen möchte, und ihr das Gefühl geben, dass sie die Situation selbst gestalten kann. Dies könnte durch einen Themenwechsel erreicht werden, der die KL interessiert, sodass das Losgehen zum Termin automatisch und ohne Widerstand erfolgt. Durch die Verschiebung des Fokus weg von der Verhärtung der Situation hin zu einer Gestaltungsmöglichkeit für die KL wird ihre Kooperationsbereitschaft erhöht.
Positives Verstärken von regelkonformem Verhalten:
Die PSA hätte den Fokus stärker auf das vergangene oder aktuelle regelkonforme Verhalten der KL legen und dieses positiv hervorheben können. Sie hätte die KL für die Aspekte loben können, die sie bei früheren Terminen erfolgreich eingehalten hat, oder sie dafür anerkennen können, dass sie pünktlich und wie vereinbart bereitsteht. Längerfristig geht es darum, dass die KL ein internes Belohnungssystem aufbaut, sodass das gewünschte Verhalten nicht mehr auf externe Verstärkungen angewiesen ist. Wenn die KL die Regeln und Vereinbarungen einhält, sollte dies durch verbale Anerkennung, kleine Belohnungen oder andere Formen der positiven Verstärkung gewürdigt werden. Sobald das gewünschte Verhalten gefestigt ist, sollten die externen Verstärkungen jedoch bewusst reduziert werden, damit das Verhalten auf dem internen Belohnungssystem der KL basiert. Dies fördert und festigt das gewünschte Verhalten auch langfristig.
Bewusstsein für längerfristiges Ziel in der Situation:
In der Situation selbst sollte die PSA das längerfristige Ziel der Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der KL betonen. Auch die PA sollte dieses Ziel im Blick haben, um gemeinsam und beständig zu handeln. Eine konsistente Kommunikation dieses Ziels hilft, Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Beteiligten am gleichen Strang ziehen.
Die PSA könnte die KL auch zur Reflexion anregen, indem sie bespricht, welche Fähigkeiten die KL bereits im Hinblick auf das Wahrnehmen von Terminen besitzt und wo sie noch Unterstützung benötigt. Dies könnte helfen, abzusprechen, ob die KL in naher Zukunft bestimmte Bereiche selbstständig bewältigen kann.
Klare Strukturierung und nicht-direktive Führung:
Nach der Theorie des Gruppendenkens von Janis könnte die PSA die zu klärenden Punkte klar strukturieren und systematisch abarbeiten. Eine offene Diskussionsumgebung, in der alle Beteiligten inklusive der BW ermutigt werden, ihre Meinungen und Ideen frei zu äussern, ohne Angst vor Kritik zu haben, kann ebenfalls helfen. Indem die PSA sich zurückhält, klare Anweisungen zu geben, und stattdessen die KL ermutigt, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wird die KL in den Entscheidungsprozess einbezogen.
Deeskalatives Intervenieren durch Aufschub und Verzögerung:
Die Theorie von Glasl besagt, dass bei heissen Konflikten, wie diesem, eine deeskalative Intervention im Vergleich zu einer eskalierenden Intervention grundsätzlich eine sinnvollere Strategie darstellt.
Nach der professionellen Deeskalation nach Mechler kann es in herausfordernden Situationen hilfreich sein, die Situation kontrolliert zu verlassen und später mit der KL zu besprechen, wie solche Situationen zukünftig vermieden werden können. So hätte die PSA, als sie die PA um Hilfe bat, den Konflikt gefasst verlassen können, um die Situation kurz zu beruhigen. Sie hätte auch ankündigen können, dass sie nun die PA um Rat bitten wird. Diese Methode hilft, die unmittelbare Eskalation zu verhindern und gibt beiden Parteien Zeit, sich zu beruhigen und die Situation zu reflektieren.
- Die PSA kommuniziert das Spannungsfeld, indem sie sich befindet, transparent gegenüber der Klientel und im Team.
Es ist sinnvoll, dass die PSA das Spannungsfeld, in dem sie sich befindet, sowohl gegenüber der KL als auch im Team transparent kommuniziert. Dies könnte bedeuten, die PA frühzeitig einzuschalten und ihr klar ihren Handlungsspielraum zu verdeutlichen. Hierbei sollte die PSA einen konkreten Wunsch an die PA äussern, damit die PA ihre Rolle als Unterstützung der PSA versteht und entsprechend handelt. Die PA sollte primär die PSA in ihrer Position bestärken und nicht direkt in die Lösung der Situation eingreifen. Bestenfalls sollte in einem grundlegenden Gespräch im gesamten Team oder konkret zwischen der PSA und der PA geklärt werden, welche Funktion und Haltung eine weitere sozialpädagogische Fachkraft einnehmen soll, wenn sie zu einer bereits bestehenden Situation hinzugezogen wird. Eine Untergrabung der Autorität der PSA durch eine weniger informierte Fachkraft kann schnell geschehen und wirkt sich negativ auf die Teamdynamik sowie die Beziehung zur Klientel aus.
Um das Spannungsfeld der PSA gegenüber der KL transparent zu machen, könnte die PSA versuchen, bei der KL einen Perspektivenwechsel zu erreichen, indem sie mit einer Ich-Botschaft gefühlsbezogen ihre eigene Lage und die Herausforderungen, die das Spannungsfeld für sie mit sich bringt, anspricht.
- Herausfordernde Situationen werden zur Nachbesprechung ins Team getragen.
Nach der Situation sollte die PSA diese ins Team bringen, um die Herausforderungen zu reflektieren, alternative Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren und langfristige Strategien zur Verbesserung der Begleitungsprozesse zu entwickeln. Es ist wichtig, dass die PSA sich zunächst bewusst darüber wird, dass die Situation tatsächlich herausfordernd war. Nachdem sie ihre Gedanken sortiert hat, kann sie die Situation im Team ansprechen. Es bedarf eines geeigneten Rahmens im Team, in dem Vertrauen herrscht, dass solche Anliegen aufgegriffen und konstruktiv besprochen werden können.
Sonstige Handlungsalternativen zur professionellen und nachhaltigen Lösung des Konflikts:
Betonung eines gemeinsamen Ziels:
Indem sich alle Teammitglieder auf dieses Ziel konzentrieren, wird die Zusammenarbeit effektiver und weniger anfällig für ineffektive Dynamiken, wie es aus der Theorie des Gruppendenkens hervorgeht. In Bezug auf das Prinzip der Ankerfunktion von Heim Omer sollten Konsequenzen klar und offen angesprochen werden, um die Ernsthaftigkeit der Situation zu verdeutlichen und somit einen sicherer Rahmen zu schaffen. Dies fördert ein Umfeld, in dem alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung bewusst sind und aktiv zur Lösungsfindung beitragen können. Eine offene Diskussionsumgebung ermöglicht es jedem Mitglied, seine Meinung frei zu äussern und zu einem konsensuellen Vorgehen beizutragen. Es wäre auch möglich gewesen, die BW direkt zu adressieren. Die PSA hätte ihr die „Lernziele“ der KL und die damit verbundenen Konsequenzen aufzeigen können, um bei ihr ein Verantwortungsbewusstsein zu fördern und sie dazu zu ermutigen, das gemeinsame Ziel zu unterstützen, anstatt der PSA konsequent zu widersprechen.
Innere Haltung verändern:
In Bezug auf das neue Verständnis von Autorität nach Heim Omer ist es wichtig, dass die PSA in der Situation die Haltung der Einflussnahme anstelle der Kontrolle einnimmt. Statt darauf zu beharren, die KL zu begleiten, könnte die PSA ihre Rolle als Unterstützerin betonen. Anstatt die Kontrolle über die Situation zu behalten, könnte die PSA versuchen, Einfluss durch Überzeugung und Zusammenarbeit auszuüben. Damit kann die PSA einen Teil der Verantwortung auf die KL übertragen und kann somit mit mehr mentaler Präsenz für die KL da sein. Die PSA könnte die Haltung der Beharrlichkeit anstelle des Gewinnens einnehmen und somit Machtkämpfe vermeiden, indem sie indem sie klar kommuniziert, warum ihre Begleitung wichtig ist, aber gleichzeitig die Wahl und Autonomie der KL respektiert.
Präsenz und aktives Engagement:
Die PSA könnte durch mehr Flexibilität und Partizipation alternative Lösungen vorschlagen oder gemeinsam mit der KL ausarbeiten, um deren Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dabei den organisatorischen Auftrag zu vernachlässigen. Es wäre ebenso wichtig, dass die PSA nach Heim Omer ihre handelnde Präsenz stärker zeigt, indem sie beispielsweise darauf besteht, dass sowohl sie als auch die KL einen anderen Raum aufsuchen, um die Diskussion fortzuführen.
Sprachlicher Bezug zur Teamarbeit:
Die PSA könnte die Formulierung von Regeln und Konsequenzen in der Wir-Form wählen. In dieser Praxis könnte sie vermehrt von „Ich will, dass du dies tust“ zu „Wir wollen, dass du dies tust“ übergehen. Heim Omer betont in seiner Theorie der Neuen Autorität, dass die Verwendung der Wir-Form die interpersonelle Präsenz verstärkt.
Wirklichkeitskonstruktion in der professionellen Deeskalation:
Wie im Kapitel 5.2.4 erläutert, ist in der Theorie der professionellen Deeskalation nach Mechler entscheidend, dass die PSA ihre Haltung und Einschätzung bezüglich der Fähigkeiten der KL überdenkt. Die PSA könnte zunächst reflektieren, wie ihre eigenen Wahrnehmungen und Erwartungen die Interaktionen mit der KL beeinflussen. Dies beinhaltet, sich bewusst zu machen, welche Annahmen sie über die Fähigkeiten und Verhaltensweisen der KL trifft. Anstatt sich ausschliesslich auf vermeintliche Defizite zu konzentrieren, könnte die PSA bewusst die Stärken und Potenziale der KL identifizieren und hervorheben. Durch eine differenzierte Betrachtung ihrer Wahrnehmungen und Erwartungsmuster könnte die PSA eine unterstützende und respektvolle Atmosphäre schaffen, die es der KL ermöglicht, sich in ihren Stärken zu entfalten und aktiv an den vereinbarten Zielen mitzuwirken. Dieser Ansatz fördert nicht nur die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der KL, sondern stärkt auch die Beziehung zwischen der PSA und der KL auf einer Basis von Vertrauen und gegenseitigem Respekt.
Konkrete deeskalative Konfrontation:
Die folgende Methode, in der Mechler sich auf das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun bezieht, könnte angewendet werden, um den Konflikt mit der KL zu entschärfen:
- Kontakt aufbauen: Den Namen der eskalierenden Person nennen, begleitet von angemessener Mimik und Tonlage.
- Sachbotschaft formulieren: Die Grenzverletzung klar und ohne Wertung oder Interpretation benennen.
PAUSE - Persönliche Wertung ausdrücken: Die persönliche Bedeutung oder Bewertung der Grenzverletzung in einer Ich-Botschaft mitteilen.
PAUSE - Appell äussern: Das gewünschte Verhalten klar in einer Ich-Botschaft formulieren.
PAUSE
Die Pausen werden eingesetzt, um die Wirkung des Gesagten zu verstärken. Die letzte Pause dient dazu, Raum zu lassen, damit das Gegenüber das Gesagte einordnen kann.
- Abels, Heinz/König, Alexandra (2016). Sozialisation – über die Vermittlung von Gesellschaft und Individuum und die Bedingungen von Identität. Wiesbaden: Springer VS. S. 96-100
- Avenir Social (2010). Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz. Bern: AvenirSocial. S. 5-11
- Glasl, Friedrich (2011). Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte Beraterinnen und Berater. 10. Aufl. Bern: Haupt. S. 198-254
- Mechler, Lars (2022). „Sicher und klar“: professionelle Deeskalation in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dortmund: verlag modernes lernen. S. 21-131
- Omer, Haim/Arist von Schlippe (2016). Stärke statt Macht Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde. Vandenhoek & Ruprecht. S. 207-208
- Omer, Haim/Haller, Regina (2020). Raus aus der Ohnmacht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 23-42
- Omer, Haim/Streit, Philip (2019). Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 18
- Röh, Dieter (2006). Die Mandate der Sozialen Arbeit. In wessen Auftrag arbeiten wir? Berlin: Westkreuz-Verlag. S. 444-445
- Staub-Bernasconi, Silvia (2018). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. 2. Aufl. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. S. 114-122
- Thiersch, Hans/Otto, Hans-Uwe (Hg.) (2020). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit revisited – Grundlagen und Perspektiven. Weinheim/Basel: Beltz Verlag. S. 9-177
- Werth, Lioba/Seibt, Beate/Mayer, Jennifer (2019). Sozialpsychologie – der Mensch in sozialen Beziehungen: Interpersonale und Intergruppenprozesse. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. S. 206-360